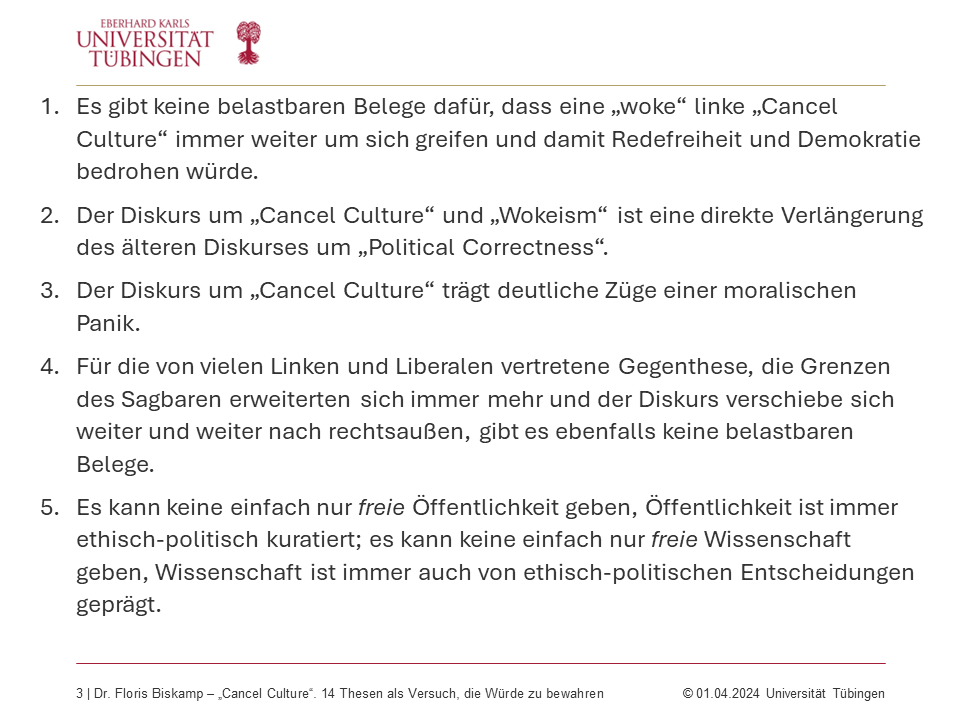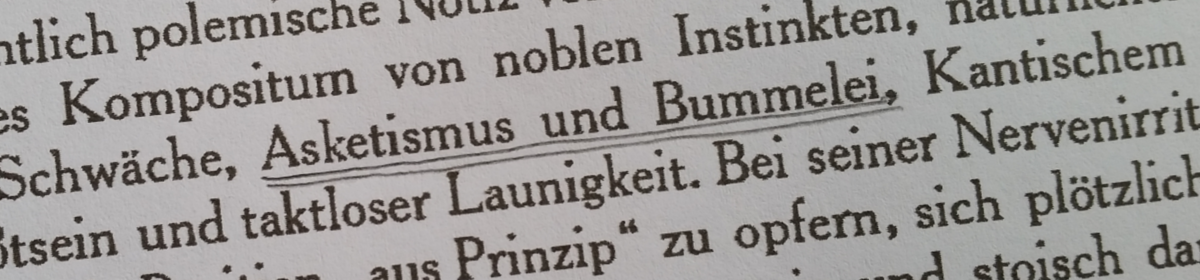Am 21. März 2024 hielt ich im Tübinger Epplehaus einen Vortrag über die “Cancel Culture”-Debatte. Im Folgenden dokumentiere ich das Manuskript.
„Wir sind von der Sache alle ziemlich angenervt, oder? Also schlage ich vor, wir sollten versuchen, wenigstens ein bisschen Würde zu bewahren.“ Dieses Zitat aus dem Film „Die üblichen Verdächtigen“ (das ich vor allem als Intro des „…but alive“-Songs „Pete“ kenne) geht mir oft durch den Kopf, wenn ich an die Debatten um Cancel Culture und die damit in Verbindung stehenden Kulturkämpfe denke. Denn ich kenne wirklich niemanden, der mit den Dynamiken dieser Debatten zufrieden wäre – wir sind von der Sache alle ziemlich angenervt. Allerdings sind wir alle auf verschiedene Weise angenervt und ich sehe nicht, wie man das auflösen könnte. Daher ist es wohl das Beste, wenn wir versuchen, wenigstens ein bisschen Würde zu bewahren.
Würdelos erscheint es mir vor allem, der Versuchung nachzugeben, sich mit Inbrunst und gezücktem Messer ins Handgemenge zu stürzen, um denen, die man von Anfang an als „Gegenseite“ identifiziert, so hart wie möglich zuzusetzen und denen, die man der „eigenen Seite“ zuordnet, den Rücken freizuhalten. Diese Versuchung ist in Kulturkämpfen immer groß, aber man sollte sich Mühe geben, ihr zu widerstehen – zumindest, wenn man versuchen will, ein bisschen Würde zu bewahren.
Ich will mir im Folgenden Mühe geben. Allerdings soll hier nicht der Anschein entstehen, ich spräche aus der perfekt ausbalanciert-neutralen Position. Ich komme in diesem Kulturkampf durchaus von einer Seite, nämlich von derjenigen, die der Diagnose einer linken Cancel Culture sehr skeptisch gegenübersteht. Allerdings will ich mir eben Mühe geben, da, wo es nötig scheint, auch meine „eigene Seite“ zu kritisieren und an anderen Stellen mit allem gebotenen Widerwillen der „anderen Seite“ Recht zu geben.
Dabei möchte ich anmerken, dass ich zwar ein Wissenschaftler bin, der sich in seiner Arbeit mit verwandten Themen beschäftigt, dies aber kein wissenschaftlicher Vortrag ist. Zudem ist die Argumentation nur halbwegs strukturiert und besteht aus 14 nicht immer aufeinander aufbauenden Thesen, die ich jeweils kurz kommentiere. 14 ist keine sehr schöne Zahl, aber 10 oder 12 reichten nicht ganz und 81 weitere wollten mir auch nicht einfallen.