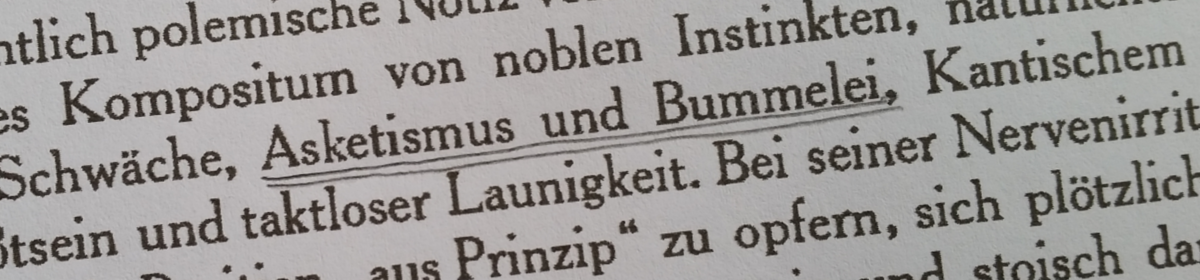Kurz vor ihrem Ende habe auch ich es zur Documenta 15 geschafft und gebe hier meine Eindrücke als politisch und kulturtheoretisch interessierter trotziger Banause mit Klassenressentiments zum Besten:
„Nun endlich das, worauf niemand gewartet hat, meine Eindrücke von der Documenta 15“ weiterlesenEin Wochenende zur Vorbereitung von Höckes Machtübernahme. Über den 13. AfD-Bundesparteitag in Riesa
Der 13. Bundesparteitag der AfD in Riesa war vor allem eins: Die Vorbereitung für Björn Höckes Wahl zum alleinigen Parteivorsitzenden im nächsten oder übernächsten Jahr. Am Wochenende wurde deutlich: Der Punkt, an dem Höcke und der Ex-Flügel in der Partei nicht mehr nur eine starke Veto-Minderheit, sondern eine tonangebende Mehrheit bilden, ist erreicht. Zwar wurde auch an diesem Wochenende nicht jeder Höcke-Antrag sofort erfolgreich durchgestimmt, aber in allen richtungsweisenden Fragen hat er sich durchgesetzt und viel wichtiger: Er hat keine Gegner:innen mehr.
„Ein Wochenende zur Vorbereitung von Höckes Machtübernahme. Über den 13. AfD-Bundesparteitag in Riesa“ weiterlesenLiebe Mit-Linke, wir müssen bei Gelegenheit mal über Demokratie reden
Liebe Mit-Linke, lasst uns bei Gelegenheit mal reden, und zwar über Demokratie.
Liebe Nicht-Mit-Linke, guckt mal da vorne, ein Eichhörnchen!
An der zögerlichen Positionierung oder völligen Nicht-Positionierung von Teilen der Linken in Deutschland wird meines Erachtens ein Defizit im Verständnis von und in der Wertschätzung für liberale Demokratie deutlich. Und das obwohl ich die meisten dabei nicht einmal für Anti-Demokrat:innen oder Gegner:innen rechtlich abgesicherter individueller Freiheit halte. Ich habe eher den Eindruck, dass es an einem positiven normativen Begriff von liberaler Demokratie mangelt.
„Liebe Mit-Linke, wir müssen bei Gelegenheit mal über Demokratie reden“ weiterlesenMännlichkeit und Vorurteil. Zwei Anmerkungen zu „Clanland“
So, nun habe auch ich den „Clanland“-Podcast gehört, in dem Mohamed Chahrour und Marcus Staiger „nicht über Clans, sondern mit Clans“ sprechen. (Late to the party, I know.)
Ich fand ihn ziemlich gut, habe aber doch zwei Anmerkungen: Zum einen frage ich mich, wie die beiden es bei diesem Thema schaffen, in zwölf ganzen Folgen nicht ein einziges Mal explizit über Geschlecht zu sprechen. Zum anderen macht das Segment „Vorurteil der Woche“ (vermutlich ungewollt) deutlich, dass „Vorurteil“ einfach nicht die richtige Kategorie ist, um das Problem zu fassen.
So, nun habe auch ich den „Clanland“-Podcast gehört, in dem Mohamed Chahrour und Marcus Staiger „nicht über Clans, sondern mit Clans“ sprechen. (Late to the party, I know.)
Vorneweg: ich fand den Podcast gelungen und hörenswert. Den beiden gelingt es, ein ziemlich sperriges und hitzig diskutiertes Phänomen multiperspektivisch einzufangen und differenziert darzustellen. Sie thematisieren die Realität arabischer Großfamilien in Deutschland und gehen dabei auch auf die vieldiskutierte (sowohl kleine als auch organisierte) Kriminalität ein. Dabei setzen sie weder Großfamilien und Kriminalität in eins noch verleugnen sie die Realität der Kriminalität.

Sie diskutieren die vielfältigen Bedingungen, die die heutige Lage hervorgebracht haben und reflektieren die rassistischen Verzerrungen des gesellschaftlichen Diskurses über diese Themen. Bei alldem schaffen sie es dann auch noch, weder effektheischend noch langweilig noch moralisierend zu sein. Und wenn ihre Recherchen in einer Frage kein wirkliches Urteil erlauben, dann urteilen sie auch nicht, sondern halten die Unklarheit fest.
Zwei Anmerkungen habe ich aber doch: Zum einen frage ich mich, wie die beiden es bei diesem Thema schaffen, in zwölf ganzen Folgen nicht ein einziges Mal explizit über Geschlecht zu sprechen. Zum anderen macht das Segment „Vorurteil der Woche“ (vermutlich ungewollt) deutlich, dass „Vorurteil“ einfach nicht die richtige Kategorie ist, um das Problem zu fassen.
„Männlichkeit und Vorurteil. Zwei Anmerkungen zu „Clanland““ weiterlesenFranziska Augstein, der Vatikan und die Identitätspolitik
Franziska Augstein hat Giacomo Casanovas Memoiren gelesen und glaubt, darin ein Argument gegen „Identitätspolitik“ gefunden zu haben. Leider bemerkt sie nicht, dass das von ihr gewählte Beispiel für das gegenteilige Argument viel besser geeignet wäre.

Lesenotiz zu “The reshaping of political representation in postgrowth capitalism”
Vor zwei Wochen erschien im Online-First/Open-Access-Format der Artikel „The reshaping of political representation in postgrowth capitalism: A paradigmatic analysis of green and right-wing populist parties” von Tilman Reitz und Dirk Jörke. Ich habe ihn gerade gelesen und einige hier spontan aufgeschriebene Anmerkungen. „Lesenotiz zu “The reshaping of political representation in postgrowth capitalism”“ weiterlesen
Cancel Culture ist abgesagt. Ausführliche Fassung des Tagesspiegel-Artikels vom 27. Mai 2020
Am 27. Mai erschien mein Text über die vermeintliche Cancel Culture an deutschen Universitäten unter dem Titel „Das Gespenst der Cancel Culture“ im Tagesspiegel. Der folgende Text ist eine ausführliche Fassung des Artikels.
Missy-Glossar zum Begriff „Postmoderne“ – Vollversion
Zur Mai-Ausgabe des Missy Magazine durfte ich einen kurzen Glossartext zum Begriff „Postmoderne“ beisteuern. Der musste für den Druck etwas gekürzt werden, hier die Vollversion, durch die insbesondere der Teil über die mögliche sinnvolle Verwendung des Begriffs etwas klarer werden könnte.
„Missy-Glossar zum Begriff „Postmoderne“ – Vollversion“ weiterlesen
Politik und Wissenschaft in der Krise. Über die Präsentation der #heinsbergprotokoll-Zwischenergebnisse am Gründonnerstag
Die gestrige Präsentation der #heinsbergprotokoll-Zwischenergebnisse wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten bietet. Aber schlimmer noch: sie lässt den Eindruck entstehen, dass Politik und Wissenschaft auf eine problematischen Art vermischt wurden. Im Folgenden erläutere ich zunächst, warum Politik und Wissenschaft sich nie trennen lassen, aber manche Verbindungen doch problematisch sind (1), rekapituliere kurz die präsentierten Zwischenergebnisse der Heinsberger Studie (2), lege dar, dass den Ergebnissen das fehlt, was Wissenschaft ausmacht: die Nachvollziehbarkeit (3), und komme deshalb zu dem Ergebnis, dass hier Politik und Wissenschaft in einer fragwürdigen Weise interagierten (4). „Politik und Wissenschaft in der Krise. Über die Präsentation der #heinsbergprotokoll-Zwischenergebnisse am Gründonnerstag“ weiterlesen
Die Fiktion der Kontrolle. Acht Punkte gegen die Vorstellung, man könne einen „Schutz der Risikogruppen“ bei „kontrollierter Durchinfektion“ erreichen
Die Forderungen, die Social-Distancing-Maßnahmen bald herunter- und das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, werden immer lauter und sie kommen aus verschiedenen Richtungen: Man hört sie aus wirtschaftsnahen Kreisen, aus Städten und Kommunen, von einigen Mediziner_innen (freilich eher von denen in Laboren und Talkshows als von denen auf den Intensivstationen), von ehemaligen Kulturstaatsministern sowie von vielen Menschen, die einfach keine Lust mehr auf den aktuellen Zustand haben. Am weitesten verbreitet ist dabei aktuell die Vorstellung, man könnte die allgemeinen Social-Distancing-Maßnahmen durch eine Art selektive Schutzisolation für Risikogruppen ersetzen. Während die besonders gefährdeten Gruppen die nächsten Monate in Heimisolation verbringen, sollen sich alle anderen, für die die Krankheit weniger lebensgefährlich ist, infizieren und immunisieren, sodass am Ende eine Herdenimmunität bestünde und die Risikogruppen aus ihrer Isolation entlassen werden könnten. Das mag für manche attraktiv und plausibel wirken. Wenn man aber ein paar Minuten darüber nachdenkt, entpuppt es sich als gefährlicher Größenwahn. „Die Fiktion der Kontrolle. Acht Punkte gegen die Vorstellung, man könne einen „Schutz der Risikogruppen“ bei „kontrollierter Durchinfektion“ erreichen“ weiterlesen