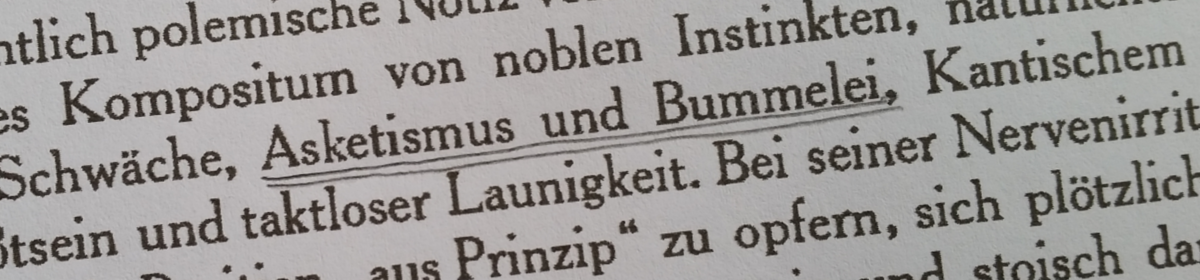Franziska Augstein hat Giacomo Casanovas Memoiren gelesen und glaubt, darin ein Argument gegen „Identitätspolitik“ gefunden zu haben. Leider bemerkt sie nicht, dass das von ihr gewählte Beispiel für das gegenteilige Argument viel besser geeignet wäre.

#Augsteins Text dreht sich um die Geschichte eines vermeintlichen Kastraten, bei dem es sich in Wirklichkeit um eine Frau handelt, die sich als kastrierter Mann ausgibt. Der Vatikan ließ seinerzeit nur männliche Sänger zu und um da singen zu können, wo es nur Männer dürfen, habe sie sich als Mann ausgeben müssen, um dies plausibel zu tun, als kastrierter. Dafür wiederum habe sie eines „künstlichen Penis“ bedurft, der vom spießigen Spiegel als „Perversität“ eingeordnet seinen Weg in den Titel gefunden hat – die Implikationen, die die Darstellung in Hinblick auf Cis- und Heteronormativität hat, wären eine eigene Diskussion wert, aber nicht hier.
Stattdessen möchte ich auf die überraschend direkte Linie eingehen, die Augstein von dieser Geschichte zur „heutigen Identitätspolitik“ zieht, die sie mit der Position des Vatikans identifiziert: Damals sei die Kirche auf die Identität derjenigen versessen gewesen, die singen, und habe verboten, dass Frauen es tun. Heute sei die Identitätspolitik auf die Identität derjenigen versessen, die schauspielern, und „verbiete“, dass Schauspieler_innen Figuren mit einer anderen Identität als der eigenen darstellen.
Was Augstein dabei völlig zu entgehen scheint: Das von ihr gewählte Beispiel ist wie gemacht für das gegenteilige Argument. Denn tatsächlich weisen gerade die Verhältnisse, gegen die sich die von Augstein problematisierten „identitätspolitischen“ Kritiken richten, deutliche Parallelen zur Position des Vatikans in Augsteins Geschichte auf: Vor 300 Jahren forcierte die Kirche die Praxis, in der alle Stimmen von Männern gesungen werden – sowohl hohe „weibliche“ als auch tiefe „männliche“ Stimmen. Heute vollzieht Hollywood (und Babelsberg) die Praxis, in der alle möglichen Rollen von normschönen, weißen, able-bodied Cis-Männern und -Frauen gespielt werden – auch wenn z.B. die Figuren der Buchvorlage diesen Normen gar nicht entsprechen. In beiden Fällen sollen also Personen derselben partikularen Gruppe diverse Rollen repräsentieren.
Filme sind heute von einer Handvoll Schauspielern und Schauspielerinnen dominiert, die mehr oder weniger geklont aussehen und in der Regel Chris oder Jennifer heißen. Wenn Filme gedreht werden, in deren Buchvorlagen mit deutlich anders aussehenden Hauptfiguren auftauchen, sind zwei Vorgänge relativ normal: Im einen Fall verwandelt die Drehbuchadaption die Geschichte kurzerhand in eine über normschöne, weiße, able-bodied Cis-Männer und -Frauen ist, obwohl die Vorlage es nicht war. Im anderen Fall unterwerfen sich Chris und Jennifer irgendwelchen aufwändigen Prozeduren, um das Andere darstellen zu können. In ersten Fall werden die erzählten Geschichten normiert, in beiden Fällen hat es zur Konsequenz, dass Schauspieler_innen, die nicht dieser Norm entsprechen, weniger Chancen auf Rollen haben: Die Rollen für normschöne, weiße, able-bodied Cis-Figuren bekommen ohnehin normschöne, weiße, able-bodied Cis-Schauspieler und -Schauspielerinnen. Die Rollen für andere Figuren werden mal herausgeschrieben und mal mit normschönen, weißen, able-bodied Cis-Schauspielern und -Schauspielerinnen besetzt.
Wenn man also die von Augsteins gewählte Geschichte zur Analogie macht, sollte man also gerade nicht diejenigen mit dem bösen Vatikan identifizieren, die dagegen protestieren, dass ihre Geschichten aufgrund dieser Praxis nicht erzählt werden oder dass sie deswegen kaum Chancen auf gute Rollen haben. Viel eher sollte diese Ehre den von Augstein verteidigten Verhältnissen zuteilwerden.
Sicher ist es nicht *dasselbe*. Die Unterschiede zwischen der Situation vor 300 Jahren und heute sind zu offensichtlich, als dass sie hier alle aufgezählt werden müssten. Hollywood erlässt keine klaren Dogmen, Hollywood lernt gerade etc. Wenn man jedoch wie Augstein eine solche Analogie aufmacht, sollte man sie auch zu Ende denken. Dann könnte man am Ende klüger sein als vorher, anstatt sich einfach nur tiefer einzugraben.
Dann kann man auch andersherum zugestehen, dass Augstein einen Punkt hat, wenn es wirklich um „Verbote“ oder um ein „Dürfen“ geht. Die Vorstellung, dass eine Rolle ausschließlich mit Personen besetzt werden dürfte, die in allen Identitätmerkmalen mit der Figur übereinstimmt, ist autoritär und führt sehr schnell in Absurditäten. Kritik kann sich darauf berufen kein Verbot zu sein, aber nur wenn sie es nicht ist.