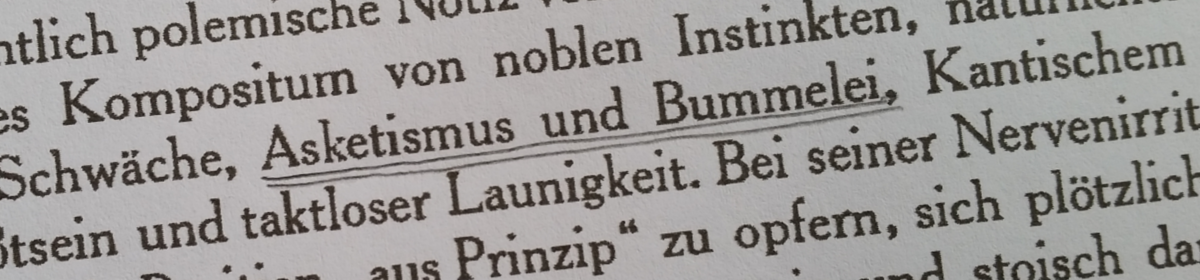Am 27. Februar 2023 fand im Rahmen der von der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz ausgerichteten Reihe „Let’s Talk About Academic Freedom“ eine Veranstaltung mit Janika Spannagel und mir statt. In meinem Vortrag legte ich in Abgrenzung zum Diskurs des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit dar, warum ethisch-politische Kritik an wissenschaftlicher Praxis legitim ist und willkommen geheißen sollte. Im Folgenden dokumentiere ich das (mit Unterstützung von DeepL ins Deutsche übertragene) Manuskript.
Die These dieses Vortrages entspricht der Caption eines etwas fragwürdigen Memes: „We live in a society.“ Etwas genauer: Als Wissenschaftler:innen betreiben wir unsere Forschung in einem sozialen Kontext, unsere Forschung ist eine soziale Praxis, die als solche reflektiert, kritisiert und diskutiert werden sollte.
Ursprünglich wollte ich diese These als Kontrapunkt zu Francesca Minerva vertreten. Leider musste sie ihre Teilnahme an der Diskussion absagen. Daher möchte ich lieber einen Kontrapunkt zu den Positionen eines anderen Akteurs setzen, der derzeit in Deutschland viel lauter ist, nämlich zu denen des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von etwa 700 überwiegend deutschen Wissenschaftler:innen, der für sich in Anspruch nimmt, die akademische Freiheit zu verteidigen. Auch wenn ich Minervas Position für deutlich weniger problematisch halte als die des Netzwerkes, gehen die Ähnlichkeiten zwischen beiden doch so weit, dass ich im Grundsatz dieselbe Argumentation gegen beide vorbringen kann.
Im Weiteren skizziere ich zunächst kurz die Position des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit zum Verhältnis von akademischer Freiheit und ethisch-politischer Kritik. Danach biete ich eine alternative Darstellung an, die lose an kritisch-theoretische Positionen von Horkheimer, Marcuse und Habermas anschließt.
Inhalt
1. Der Diskurs des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit
1.1 Das Verhältnis von Wahrheit und Normativität in der wissenschaftlichen Praxis
Ich möchte mich auf einen Aspekt im Diskurs des Netzwerkes konzentrieren, nämlich auf die Darstellung akademischer Praxis als unbeirrte Suche nach Wahrheit, die nicht durch moralische, ethische und politische Kritik, durch „Dogma“ oder „Ideologie“ behindert werden sollte.
Nach diesem Diskurs zielt Wissenschaft darauf, die Wahrheit um ihrer selbst willen finden – die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ohne Wenn und Aber. Freilich weiß das Netzwerk, dass Wissenschaftler:innen mit ihren Wahrheitsansprüchen falsch liegen können und dass Wahrheitssuche immer ein unabgeschlossener Prozess bleiben muss. Und genau deshalb setzt es sich für einen offenen Diskurs ein, in dem die Ergebnisse der Wissenschaft ständiger Kritik ausgesetzt sein sollen. Das Netzwerk betont aber, dass es in diesem Diskurs nur um Wahrheit gehen darf, nicht um Ethik oder Politik oder andere „wissenschaftsfremde“ Kriterien. Es will die Reinheit des wissenschaftlichen Wahrheitsdiskurses vor Übergriffen durch einen ethisch-politischen Diskurs schützen.[1]
Wenn man dieses Argument in der Terminologie der Habermas’schen Formulierung der Sprechakttheorie rekonstruiert (die das Netzwerk freilich nicht verwendet), kann man es als Betonung der Unterscheidung zwischen zwei verschiedener Arten von Geltungsansprüchen und Diskursen verstehen, von denen nur eine bzw. einer in die Wissenschaft gehört. Nach Habermas bedeutet Sprechen, Geltungsansprüche zu erheben, die von anderen verstanden, ggf. kritisiert und dann wiederum mit Gründen verteidigt werden können, so dass diskursive Klärung stattfinden und kommunikative Vernunft wirken kann. Zwei dieser Geltungsansprüche, die wir beim Sprechen erheben, sind propositionale Wahrheitsansprüche und normative Richtigkeitsansprüche. Wahrheitsansprüche sind Aussagen darüber, wie die Welt ist: „Materie wird von Gravitation affiziert“, „Deutschland ist ein Nationalstaat“ usw. Richtigkeitsansprüche sind Aussagen darüber, wie die Welt sein sollte – und sie beziehen sich daher meist auf menschliches Handeln oder soziale Institutionen: „Du sollst nicht lügen!“ „Menschenrechte sollten geachtet werden!“ „Es sollte weniger wirtschaftliche Ungleichheit geben!“ Wahrheitsansprüche sind Teil von Wahrheitsdiskursen, Richtigkeitsansprüche sind Teil von ethisch-politischen Diskursen.
Das Bild, das das Netzwerk von akademischer Praxis zeichnet, legt nahe, dass der akademische Diskurs auf Wahrheitsdiskurse beschränkt sein sollte. Wissenschaftler:innen suchen nach Wahrheit und erheben Wahrheitsansprüche auf der Grundlage bestehender und eigener Forschungsergebnisse. Diese Wahrheitsansprüche sollen dann von anderen Wissenschaftler:innen überprüft und kritisiert werden.
Dieser Diskurs soll nach Ansicht des Netzwerks jedoch eben ein reiner Wahrheitsdiskurs sein, kein ethisch-politischer Diskurs. Der Wahrheitsanspruch „p ist wahr“ kann demnach mit dem konkurrierenden Wahrheitsanspruch „p ist nicht wahr“ bestritten werden, aber niemals mit dem Richtigkeitsanspruch „p ist moralisch falsch“. Zum Beispiel können Sarrazinöse Behauptungen wie „Weiße Menschen sind x% intelligenter als nicht-weiße Menschen“ mit der Behauptung „Weiße Menschen sind nicht intelligenter als nicht-weiße Menschen“ angefochten werden – sofern man denn Gründe dafür angeben kann. Nicht angefochten werden können sie jedoch mit der Behauptung „Diese Aussage ist rassistisch“ – ganz egal, wie gut die Gründe für diese Aussage sein mögen (dies gilt zumindest, sofern man „rassistisch“ als wertende Kategorie versteht).
1.2 Das resultierende Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
Die akademische Freiheit, die das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit verteidigen will, bezieht sich also auf die Freiheit der Wissenschaftler:innen, einen Wahrheitsdiskurs zu führen, ohne durch einen ethisch-politischen Diskurs behelligt zu werden. Eine solche Einschränkung des akademischen Diskurses auf Wahrheitsansprüche ist offensichtlich kompliziert, wenn man akademische Disziplinen wie die Praktische Philosophie oder die Rechtswissenschaft betrachtet. Aber ich möchte diese Fragen hier ausklammern – ich bitte die 90% Jurist:innen im Raum um Entschuldigung.
Wenn ich diese Fragen ausklammere, kann ich durchaus verstehen, dass dieses Bild von Wissenschaftler:innen als unermüdlicher Sucher:innen der Wahrheit für viele Kolleg:innen attraktiv und schmeichelhaft ist. Doch aus Gründen, die ich später erläutern werde, glaube ich nicht, dass dies auch nur annähernd dem entspricht, was in der Wissenschaft tatsächlich geschieht. Mehr noch: Ich kann es nicht einmal als ein Ideal akzeptieren, das wir anstreben sollten.
1.3 Das Bild von moralischer Kritik und „Cancel Culture“
Doch bevor ich dies näher begründe, muss ich noch fragen: Was sind nach Ansicht des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit die dringendsten Bedrohungen für die so verstandene akademische Praxis und ihre Freiheit? Die Antwort lautet: Die Eskalation einer moralistischen Cancel Culture, die vor allem von linkem Aktivismus getragen wird. Dieser Aktivismus gefährde den freien akademischen Diskurs, indem er öffentliche moralische Urteile über Forscher und ihre Äußerungen fälle und damit einen „chilling effect“ (Kostner, 2022, S. 9) ausübe, der die freie wissenschaftliche Praxis behindere.
Natürlich steht das Netzwerk mit dieser These nicht allein. In Deutschland wird sie auch durch verschiedene Medien verbreitet, insbesondere durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (insbesondere einen Journalisten derselben), Die Welt und die Neue Zürcher Zeitung. Darüber hinaus bekennt sich sogar der Deutsche Hochschulverband als Organisation der deutschen Professoren dazu.
2. Alternativvorschlag
2.1 Das Verhältnis von Wahrheit und Normativität in der wissenschaftlichen Praxis
Nun zu meinem alternativen Verständnis von wissenschaftlicher Praxis und Wissenschaftsfreiheit: Was finde ich an den Positionen des Netzwerks falsch? Der erste und wichtigste Punkt ist: Ich glaube nicht, dass es eine reine, von ethisch-politischen Fragen unabhängige Wahrheitssuche geben kann – so verlockend die Vorstellung auch sein mag.
Akademische Praxis ist hoffentlich immer auch, vielleicht sogar in erster Linie eine Suche nach der Wahrheit, aber sie kann es nie ausschließlich sein. Der Grund dafür ist einfach: Die Zahl von Wahrheiten, die wir potenziell entdecken oder produzieren könnten, ist unendlich; die Zahl der Wahrheiten, die wir real entdecken oder produzieren können, ist dagegen sehr begrenzt. Die Entscheidung darüber, welche Wahrheiten wir produzieren oder entdecken sollen, hat immer eine ethisch-politische Dimension. Es geht dabei auch um Richtigkeitsansprüche, nicht nur um Wahrheitsansprüche.
Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin kein Relativist, der behauptet, es gäbe keine Wahrheit und alle Sichtweisen seien gleichermaßen gültig. Ich bin auch kein Nietzscheaner, der Wahrheit auf eine Funktion der Macht reduziert. Keine dieser beiden Positionen ist haltbar. Ich bin überzeugt, dass solide Wissenschaft gültige Ergebnisse hervorbringen kann, die verstanden, mit Vernunftgründen kritisiert und diskutiert sowie von anderen Wissenschaftlern unabhängig reproduziert werden können. Wie wir aus der Replikationskrise in der Psychologie und anderen Disziplinen gelernt haben, ist diese Annahme prekärer, als man hoffen möchte. Aber im Prinzip ist solche Wissenschaft möglich und wünschenswert und in gewissem Maße auch Teil der Realität.
Dies gilt für die Naturwissenschaften, die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften in je unterschiedlicher Weise. Mögliche, im Prinzip beantwortbare Fragen sind zum Beispiel: Ist kontrollierte Kernfusion möglich und unter welchen Bedingungen kann sie technisch genutzt werden? In welchem Maße war der Wohnungsmarkt in Köln im Jahr 2022 von Rassendiskriminierung geprägt? Wie werden Identitäten in portugiesischen Liebesromanen aus den 1860er Jahren konstruiert? Wenn wir uns einmal für eines dieser Themen, für spezifische Forschungsfragen und eine bestimmte Methodik entschieden haben und unseren Job anständig machen, können wir Ergebnisse finden, die andere verstehen, kritisieren und reproduzieren können. Und in dem Maße, in dem diese Ergebnisse der Kritik standhalten, können wir sie als (vorläufige) Wahrheiten bezeichnen.
Aber nun kommt der Haken: Bevor wir diese Wahrheiten entdecken, müssen wir entscheiden, welche Themen wir ansprechen und wie wir es tun: Um es klischeehaft zu formulieren: Sollen Naturwissenschaftler:innen nach Wahrheiten über effektivere Bomben oder über effektivere Wege der Nahrungsmittelproduktion suchen, nach Wahrheiten über Haarwuchsmittel oder über Malariamittel? Sollen Sozialwissenschaftler:innen nach effektiveren Herrschaftstechniken oder nach effektiveren Wegen des Widerstands gegen Herrschaft suchen? Sollten Geisteswissenschaftler:innen nach Wahrheiten über die Quellen wahrer künstlerischer Genialität suchen oder nach Wahrheiten über die Art und Weise, wie soziale Herrschaftsverhältnisse in Kunstwerken reflektiert, reproduziert oder untergraben werden?
Man könnte argumentieren, dass Wissen immer besser ist als Unwissenheit und es daher wünschenswert wäre, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit über all diese Fragen erfährt. Ich bin unschlüssig, ob dies richtig ist. Aber zum Glück ist das für mein Argument nicht wichtig: Wichtig ist, dass Forschung immer eine Entscheidung darüber voraussetzt, was erforscht werden soll. Selbst wenn alles Wissen per se wünschenswert wäre, gibt es zumindest Opportunitätskosten: Die Zahl der Wissenschaftler:innen und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen sind begrenzt. Daher können wir nur eine begrenzte Anzahl von Fragen erforschen und müssen einigen den Vorrang gegenüber anderen einräumen. Und diese Prioritätensetzung kann nicht allein aus wissenschaftlichen Gründen vorgenommen werden. Die Frage, welchen Wahrheiten wir nachgehen sollen, lässt sich nicht allein mit Wahrheitsansprüchen beantworten. Die Antwort muss wie bei allen praktischen Fragen immer auch Richtigkeitsansprüche beinhalten – implizit oder explizit.
Natürlich sind diese Antworten teilweise von wissenschaftlichen Überlegungen geprägt: Was ist der aktuelle Stand der Forschung? Welche Forschungslücken gibt es? Welche Theorien und Methoden werden üblicherweise angewandt und versprechen die besten Ergebnisse? Wir müssen immer nahe genug an der bestehenden Forschung sein, damit unsere Arbeit als Wissenschaft gilt, und wir müssen weit genug über sie hinausgehen, damit sie als innovativ gilt. Jedoch können solche wissenschaftlichen Überlegungen die Entscheidungen nie vollständig bestimmen. Es gibt immer Millionen von Forschungslücken, die wir angehen könnten, und wir könnten sie immer aus verschiedenen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Methoden usw. angehen. Die Entscheidung für je eine davon hat immer auch eine ethisch-politische Dimension. Und der gegenwärtige Stand der Forschung selbst wird durch die Sedimentation ethisch-politischer Entscheidungen aus der Vergangenheit geformt, sodass auch eine Orientierung daran nicht frei von Normativität ist.
Wenn ich also sage, dass es unendlich viele Wahrheiten gibt, die wir produzieren könnten, wir aber immer nur einige wenige produzieren können, dann ist das kein erkenntnistheoretischer Relativismus. Es unterstreicht nur die Tatsache, dass selbst die beste Wissenschaft Entscheidungen voraussetzt, die niemals allein auf wissenschaftlichen Wahrheitsdiskurse beruhen können, sondern immer auch eine ethisch-politische Dimension haben.
Mit anderen Worten: Das wissenschaftliche Streben nach Erkenntnis hat immer mit menschlichem und manchmal allzumenschlichem Interesse zu tun – sei es das Interesse an technologischer Anwendung, an Herrschaft, an Emanzipation oder an Karriere. Es kann nicht anders sein. Wir können diese Tatsache natürlich ignorieren, wie es viele Kolleg:innen tun. Aber das lässt die Tatsache nicht verschwinden. Die Folge einer solchen Ignoranz ist in der Regel, dass die ethisch-politischen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, entweder von unseren persönlichen Vorurteilen oder von gesellschaftlichen Kräften und Ideologien geprägt sind, die uns nicht bewusst sind. Dann reproduziert unser Wunsch, frei von Ideologie zu sein, Ideologien, derer wir uns nicht bewusst sind.
Die aufgeklärte Alternative zu einer solchen ideologischen Ignoranz besteht freilich nicht darin, bewusst „die richtige Ideologie zu wählen“, sondern diese ethisch-politischen Urteile systematisch zu reflektieren und auf eine möglichst universalistische Grundlage zu stellen.

2.2 Das resultierende Verständnis von Wissenschaftsfreiheit
Wenn man dieses Argument akzeptiert, was bedeutet es dann für die Wissenschaftsfreiheit?
Erstens möchte ich betonen: Auch ich bin der Ansicht, dass die Integrität des wissenschaftlichen Prozesses vor ethisch-politischen Eingriffen geschützt werden sollte, aber zunächst in einem kleineren Rahmen: Wenn Wissenschaftler:innen beschließen, sich mit einer bestimmten Frage zu befassen, haben sie die Pflicht, dieser nachzugehen und die Ergebnisse zu veröffentlichen – unabhängig davon, ob sie ihren eigenen oder den gesellschaftlich dominanten normativen Erwartungen entsprechen oder nicht (und auch unabhängig davon, ob sie spektakulär sind, s. Replikationskrise). Auch ich bin der Meinung, dass Wahrheitsansprüche nicht durch Legitimitätsansprüche entkräftet werden können.
Zweitens: Wenn Wissenschaftler:innen diese Pflicht haben, muss sichergestellt sein, dass sie sie auch erfüllen können. Das bedeutet, dass alle Versuche, sie zu zwingen, etwas anderes zu tun – sei es durch die Regierung oder durch private Akteure – verboten sein müssen.
Drittens: Auch wenn ich behaupte, dass Forschung immer ethisch-politische Entscheidungen beinhaltet, glaube ich dennoch, dass es gute normative Gründe gibt, ein hohes Maß an Autonomie für Wissenschaftler:innen zu fordern, um diese Entscheidungen untereinander ohne äußeren Zwang treffen zu können. Das gilt nicht etwas deshalb, weil Wissenschaftler:innen in einzigartiger Weise qualifiziert wären, diese ethisch-politischen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube nicht, dass sie das sind. Aber wenn Wissenschaftler:innen nicht über eine solche Autonomie verfügen, ist es fast sicher, dass die Entscheidungen von dominanten gesellschaftlichen Kräften (Staaten, Unternehmen) getroffen werden. Die akademische Autonomie bietet einen gewissen unvollkommenen Schutz davor.
Bis zu diesem Punkt bin ich dem Diskurs des Netzwerks relativ nahe, aber nun trennen sich unsere Wege.
Denn ich möchte viertens betonen, dass Autonomie nicht diskursive Isolation kann oder sollte. Ethisch-politische Entscheidungen sind keine bloßen idiosynkratischen Präferenzen. Sie sind Urteile, die mit Gründen getroffen werden können. Ähnlich wie Wahrheitsansprüche können auch Richtigkeitsansprüche in öffentlichen ethisch-politischen Diskursen geäußert, verstanden, kritisiert und begründet werden. Und Wissenschaftler:innen haben sehr gute Gründe, offen dafür zu sein, dass ihre eigenen ethisch-politischen Entscheidungen von gesellschaftlichen Akteuren außerhalb der Wissenschaft kritisiert werden.
Denn die Qualität der ethisch-politischen Entscheidungen wird besser sein, wenn die Perspektiven von mehr betroffenen Akteuren gehört werden. Der akademische Bereich ist jedoch sozial immer noch recht homogen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Wissenschaftler:innen, deren ethisch-politische Entscheidungsfindung von „wissenschaftsfremder“ Kritik abgeschirmt bleibt, den Vorurteilen ihres sozialen Umfelds folgen – nicht nur in ihrer Methodik, sondern vor allem in den ethisch-politischen Entscheidungen darüber, was geforscht wird. Die Offenheit für normative Kritik von außen hat das Potenzial, die ethisch-politischen Entscheidungen der Wissenschaftler:innen verbessern.
In der Vergangenheit wurde der extreme Heterosexismus und Rassismus in der Wissenschaft nicht allein durch reine Wahrheitsdiskurse unter Wissenschaftler:innen gemindert, sondern auch durch ethisch-politische Interventionen von Feminist:innen und Antirassist:innen. Diese Interventionen waren nicht immer höflich – und sie wären wahrscheinlich weniger wirksam gewesen, wenn sie immer höflich gewesen wären.
In diesem Sinne bin ich der Ansicht, dass Wissenschaftler:innen gegenüber der Öffentlichkeit verantwortlich sein sollten. Dies gilt nicht in dem Sinne, dass sie von äußeren Akteur:innen zur Verantwortung gezogen werden können sollten – Zwang sollte von den gängigen rechtlichen und forschungsethischen Einschränkungen ausgeschlossen bleiben. Sie sollten aber für Kritik von außen offen sein und eine innere Verpflichtung spüren, diese ernstzunehmen und ihr zu antworten. Denn sie sollten sich bewusst sein, dass ihre Forschung ethisch-politische Entscheidungen voraussetzt. Sie sollten sich bewusst sein, dass sie nicht perfekt geeignet sind, diese Entscheidungen auf sich allein gestellt zu treffen. Und sie sollten sich bewusst sein, dass sie diese Entscheidungen besser treffen können, wenn sie offen für Kritik von außen sind und sich darauf einlassen.
2.3 Das Bild von moralischer Kritik und „Cancel Culture“
Wenn wir also die akademische Freiheit auf diese Weise verstehen, wie groß sieht dann die Gefahr von Cancel Culture aus?
Auch ich bin der Ansicht, dass es bestimmte Formen des linken Aktivismus gibt, die moralistisch, problematisch und sogar autoritär sind. Viele Aktivist:innen – studentische und andere – haben recht weit gefasste Begriffe von Rassismus, Heterosexismus, Antisemitismus, Rechtsradikalismus usw. Das ist an sich legitim – auch wenn ich Zweifel an einigen dieser Begriffe und an einigen der darauf basierenden Urteile habe. Um es deutlich zu sagen: Ich finde immer wieder, dass Äußerungen von Kolleg:innen Rassismus, Heterosexismus und ähnliches enthalten, und ich bin froh, wenn sie darauf einigermaßen deutlich hingewiesen werden. Und wenn diese Kritik zu einer Kultur beiträgt, in der Menschen über den Inhalt ihrer Rede nachdenken, bevor sie sprechen, halte ich das nicht per se für eine schlechte Sache. Es kann ein Beitrag zu moralischem Lernen sein.
Was ich problematischer finde, sind die essentialistischen Tendenzen in einigen dieser Kritiken: Dann werden Rassismus, Heterosexismus, Antisemitismus usw. nicht mehr als Problem einer bestimmten Äußerung kritisiert. Vielmehr werden sie als Charaktereigenschaft einer Person betrachtet, die dann als Rassist:in, Sexist:in, Antisemit:in usw. und damit als böses Individuum gilt. Eine solche Moralisierung ist in den meisten Fällen weder angemessen noch hilfreich.
Schließlich neigen einige dieser Aktivist:innen dazu, sehr weitgehende Schlussfolgerungen aus ihrer Kritik zu ziehen. Sobald sie eine Person als rassistisch, heterosexistisch, antisemitisch oder generell rechtslastig identifiziert haben, fordern sie, dass diese Person aus der akademischen Welt verbannt werden sollte. Solche Forderungen mögen in wenigen Fällen angemessen sein, sind aber in den meisten Fällen schlichtweg autoritär und antipluralistisch – und ihre Umsetzung wäre in der Tat ein Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit.
Und deshalb bin ich froh, dass der Einfluss dieser Art von Aktivismus sehr begrenzt zu sein scheint. Ich verfolge regelmäßig die vom Netzwerk angebotene „Dokumentation“, aber ich sehe einfach keine Beweise dafür, dass ein solcher Aktivismus die akademische Freiheit in Deutschland ernsthaft bedrohen würde. Ich sehe auch keine Belege dafür, dass diese Art von Aktivismus im Laufe der Zeit tatsächlich eskaliert ist. Wenn wir bedenken, wie Campus-Politik in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren funktionierte, erscheint sie heute als relativ liberal und harmlos. Ich sehe keine Verschärfung des Protests, sondern eher eine wachsende Sensibilität und Sichtbarkeit aufgrund der Verbreitung digitaler Medien.
Und ehrlich gesagt finde ich es lächerlich, wenn Professor:innen mit Beamt:innenstatus und einem W3- oder C4-Gehalt über eine Gefährdung ihrer akademischen Freiheit klagen, weil eine Handvoll Studenten sie in den sozialen Medien oder in irgendeinem Blog angreift oder weil sie unfreundliche E-Mails erhalten. Wissenschaftsfreiheit ist keine Garantie, geliebt zu werden, sondern eine Garantie, auch dann weiterforschen zu können, wenn man nicht geliebt wird. Diese Klage über unfreundliches Feedback ist umso absurder, wenn man bedenkt, was Personen, die über Rechtsextremismus und Rassismus forschen, sowie viele Frauen, Queers und People of Color, die sich öffentliche äußern, zu ertragen haben.
3. Einige abschließende Punkte:
Erstens habe ich aufgrund meiner Fokussierung auf das Verhältnis von Wahrheitsdiskurs und ethisch-politischem Diskurs noch gar nicht über die Heuchelei einiger Akteure im Netzwerk gesprochen, die routinemäßig andere Wissenschaftler auf höchst moralisierende und polemische Weise angreifen, aber laut „Foul“ schreien, wenn ihnen oder ihren Verbündeten ähnliches widerfährt. Einige schreien „Cancel Culture“, wenn Rassismus vorgeworfen wird, verteilen aber selbst in nicht weniger verallgemeinerter Weise Antisemitismusvorwürfe. Solche Inkonsistenzen sind freilich kaum überraschend, wenn man meiner Argumentation folgt: Wenn die akademische Praxis immer ethisch-politische Entscheidungen beinhaltet, kann die Forderung, diese aus der akademischen Praxis herauszuhalten, niemals kohärent verfolgt werden. Dennoch ist die aggressive Art und Weise, in der diese Praxis von einigen Mitgliedern des Netzwerks betrieben wird, verblüffend (Strick & Schaffer, 2023).
Zweitens ist die Art und Weise, auf die das Netzwerk Fälle von Cancel Culture sammelt, selbst höchst problematisch. Die Falldarstellungen beruhen immer wieder auf Artikeln des FAZ-Journalisten Thomas Thiel, in dessen Texten sich regelmäßig Un- sowie Halbwahrheiten finden und der sich in einem Feedbackloop mit dem Netzwerk befindet.
Drittens versäumt es das Netzwerk routinemäßig, zwischen der von Wissenschaftsfreiheit gedeckten Forschungstätigkeit von Wissenschaftler:innen und politischen Konflikten unter Beteiligung von Wissenschaftler:innen zu unterscheiden. In vielen Fällen, die sie anführen, geht es jedoch überhaupt nicht um akademische Forschung, sondern um Forscher, die sich politisch äußern oder politische Redner an die Universität einladen. Solche Aktivitäten sind von Natur aus politisch und daher unabhängig von allem oben Geschriebenen ein legitimer Gegenstand politischer Kritik. Sie sind durch die Meinungs- aber nicht durch die Wissenschaftsfreiheit gedeckt. Die Frage, wer nach welchen Kriterien darüber entscheiden sollte, welche „allgemeinpolitischen“ Debatten auf dem Campus stattfinden sollen, ist alt und relevant. Aber das Netzwerk kann zu dieser Debatte nicht produktiv beitragen, wenn sie sie mit der Frage der Wissenschaftsfreiheit in einen Topf wirft.
Viertens: In den oben formulierten Überlegungen ausgeklammert blieb die Frage, in welche Art von Gesellschaft wissenschaftliche Praxis eingebettet ist – in eine nationalstaatlich organisierte kapitalistische Gesellschaft. Dies angemessen zu berücksichtigen bedürfte deutlich längerer Ausführungen.
Fünftens: Ich sehe einige tatsächliche Probleme die Autonomie der Wissenschaften in Deutschland. Dazu zählt das Befristungswesen sowie die Ausweitung der Drittmittelfinanzierung, die wir seit der Jahrtausendwende erleben. Letztere hat zwar einige Vorteile, bedeutet aber auch, dass die damit verbundenen ethisch-politischen Entscheidungen in zunehmendem Maße durch externe Akteure wie Ministerien und private Stiftungen geprägt werden. Dieses Problem wird noch verschärft, wenn die Forschung selbst nicht im akademischen Bereich, sondern in privaten Unternehmen oder Stiftungen betrieben wird.
Diese Themen verdienen mehr Aufmerksamkeit als das Schreckgespenst einer Cancel Culture.
Literatur
Coelln, C. von. (2022). Der Streit um die Grenzen des Sagbaren an Hochschulen im Lichte von Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit. Oder: Wie ein Grundrecht funktioniert. In S. Kostner (Hrsg.), Wissenschaftsfreiheit: Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft ist: Zeitschrift für Politik. Sonderband 10 (S. 91–104). Nomos. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748928058/wissenschaftsfreiheit?page=1
Frick, M.-L. (2022). Umkämpfte Wissenschaft, komplizierte Freiheit. Ein philosophischer Beitrag zur Debatte um die Lage der Wissenschaftsfreiheit. In S. Kostner (Hrsg.), Wissenschaftsfreiheit: Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft ist: Zeitschrift für Politik. Sonderband 10 (S. 55–72). Nomos. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748928058/wissenschaftsfreiheit?page=1
Kostner, S. (2022). Wissenschaftsfreiheit Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft is. In S. Kostner (Hrsg.), Wissenschaftsfreiheit: Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft ist: Zeitschrift für Politik. Sonderband 10 (S. 7–30). Nomos. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748928058/wissenschaftsfreiheit?page=1
Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. (2021, Februar). Manifest. https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/manifest/
Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. (2023). Dokumentation. https://www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de/dokumentation/
Pautsch, A. (2022). Wissenschaftsfreiheit in Zeiten der Anfechtung. Bestand und Gefährdungen des Art.5 Abs.3 Satz1 GG. In S. Kostner (Hrsg.), Wissenschaftsfreiheit: Warum dieses Grundrecht zunehmend umkämpft ist: Zeitschrift für Politik. Sonderband 10 (S. 73–90). Nomos. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748928058/wissenschaftsfreiheit?page=1
Strick, S., & Schaffer, J. (2023, Februar 23). Zoff um Genderforschung: Verunglimpfen, polemisieren, eskalieren. Der Tagesspiegel Online. https://www.tagesspiegel.de/wissen/das-beleidigungsnetzwerk-der-verein-der-pobelnden-professoren-9390224.html
[1] Hier einige Zitate aus dem „Manifest“ des Netzwerkes: „Wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll. Wir müssen vermehrt Versuche zur Kenntnis nehmen, der Freiheit von Forschung und Lehre wissenschaftsfremde Grenzen schon im Vorfeld der Schranken des geltenden Rechts zu setzen. Einzelne beanspruchen vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung und ihrer politischen Ziele, festlegen zu können, welche Fragestellungen, Themen und Argumente verwerflich sind. Damit wird der Versuch unternommen, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Auf diese Weise wird ein Konformitätsdruck erzeugt, der immer häufiger dazu führt, wissenschaftliche Debatten im Keim zu ersticken.“ „Hochschulangehörige werden erheblichem Druck ausgesetzt, sich bei der Wahrnehmung ihrer Forschungs- und Lehrfreiheit moralischen, politischen und ideologischen Beschränkungen und Vorgaben zu unterwerfen: Sowohl Hochschulangehörige als auch externe Aktivisten skandalisieren die Einladung missliebiger Gastredner, um Druck auf die einzuladenden Kolleginnen und Kollegen sowie die Leitungsebenen auszuüben. Zudem wird versucht, Forschungsprojekte, die mit den weltanschaulichen Vorstellungen nicht konform gehen, zu verhindern und die Publikation entsprechend missliebiger Ergebnisse zu unterbinden.“ „Dazu wird das Netzwerk […] für eine Debattenkultur eintreten, in der alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierenden ihre Erkenntnisinteressen frei von Sorgen vor moralischer Diskreditierung, sozialer Ausgrenzung oder beruflicher Benachteiligung verfolgen und ihre Argumente in Debatten einbringen“ (Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, 2021). Hier aus der Vorrede zur Falldokumentation: „Kritik und Widerspruch sind elementare Bestandteile des wissenschaftlichen Diskurses in offenen Gesellschaften. Wogegen sich die Mitglieder im Netzwerk wehren, sind Diffamierungen, wenn statt eines inhaltlichen Widerspruchs eine moralisch diskreditierende politische Einordnung einer Person selbst oder ihres Arguments vorgenommen wird (etwa als ‚Nazi‘ oder ‚Rechtsextremist‘, ‚Rassist‘, ‚Islamfeind‘ oder ‚Menschenfeind‘, ‚Antisemit‘ ebenso wie ‚Linksfaschist‘, ‚Islamist‘, ‚Terrorist‘ oder ‚linksversifft‘). Diffamierungen können auch über subtilere Zuschreibungen wirksam werden (‚anschlussfähig an rechte Diskurse‘, ‚umstritten‘, ‚verharmlosend‘ oder ‚auf dem linken Auge blind‘). Gemeinsam ist solchen Diffamierungen, dass sie die betroffene Person als zu meidend markieren und damit aus dem Diskurs ausschließen. Sie fungieren zugleich als Orientierung und Warnung: Wer mit der diffamierten Person zusammenarbeitet, ihr ‚eine Bühne bietet‘, Zuspruch signalisiert oder auch nur Solidarität, ist gleichfalls ‚schuldig‘“ (Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, 2023). Das Problem beginnt demnach nicht erst, wenn Personen als Personen angegriffen oder diffamiert werden, sondern bereits, wenn bestimmte Äußerungen als normativ problematisch kritisiert werden. Die konzeptuellen Beiträge im jüngsten Sammelband sind freilich differenzierter, auch sie verteidigen aber auf je unterschiedliche Art die Idee einer zweckfrei wahrheitssuchenden Wissenschaft, die gegen wissenschaftsfremde Kritik verteidigt werden müsse (Coelln, 2022; Frick, 2022; Pautsch, 2022).