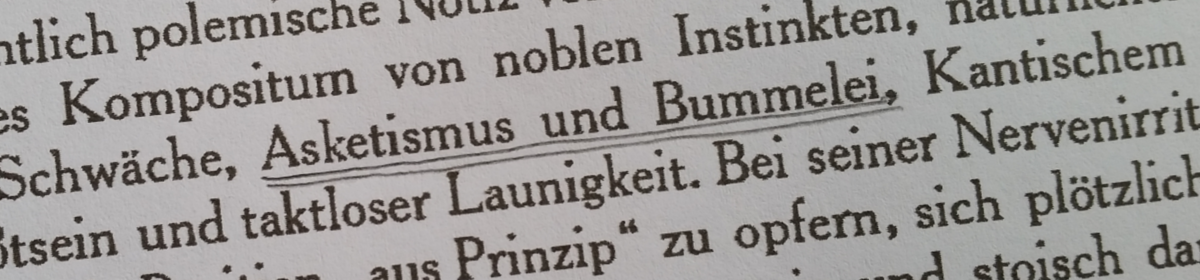Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht fordern im Namen der sozialen Gerechtigkeit und des Kampfes gegen die AfD, dass die Partei Die Linke eine restriktivere Linie in der Flüchtlingspolitik vertreten soll. Diese Forderung ist ohne Wenn und Aber zurückzuweisen. Dabei sollte der von beiden angesprochene Konflikt zwischen einer offenen Migrationspolitik und den Interessen von Teilen der Bestandsbevölkerung aber nicht naiv verleugnet, sondern von links bearbeitet werden.
Floris Biskamp
Zwei Tage nach der Wahl präsentierte der ehemalige Linksparteivorsitzende Oskar Lafontaine auf Facebook eine Wahlanalyse, die sich wie die Elaboration eines Kommentars liest, den Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht noch am Wahlabend in einem ARD-Interview zum Besten gab. Sie hatte darüber spekuliert, ob die Linke es sich „vielleicht auch in der Flüchtlingsfrage wirklich zu einfach gemacht“ und deshalb Stimmen an die AfD verloren habe.

Diesen als Selbstkritik getarnten Angriff gegen innerparteiliche Gegner_innen führte Lafontaine zwei Tage später weiter. Das zweitbeste Ergebnis der Parteigeschichte erweise sich als Misserfolg, wenn man bedenke, wie gering die Zustimmung unter Arbeiter_innen und Arbeitslosen ausgefallen sei, die doch eigentlich die Kernwähler_innenschaft einer linken Partei stellen sollten. Dies führt Lafontaine auf denselben „Fehler“ zurück wie Wagenknecht:
Der Schlüssel für diese mangelnde Unterstützung durch diejenigen, die sich am unteren Ende der Einkommensskala befinden, ist die verfehlte ‚Flüchtlingspolitik‘.
„Verfehlt“ sei „die Flüchtlingspolitik“ sowohl der Regierung als auch der Linkspartei, weil sie die Interessen der Arbeiter_innen und Arbeitslosen in Deutschland ignoriert habe:
Man darf die Lasten der Zuwanderung über verschärfte Konkurrenz im Niedriglohnsektor, steigende Mieten in Stadtteilen mit preiswertem Wohnraum und zunehmende Schwierigkeiten in Schulen mit wachsendem Anteil von Schülern mit mangelnden Sprachkenntnissen nicht vor allem denen aufbürden, die ohnehin bereits die Verlierer der steigenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen sind. Die Erfahrung in Europa lehrt: Wenn diese Menschen sich nicht mehr durch linke bzw. sozialdemokratische Parteien vertreten fühlen, wählen sie in zunehmendem Maße rechte Parteien.
Lafontaine rechtfertigt also eine restriktivere Migrationspolitik im Namen der sozialen Gerechtigkeit als Schutz der sozial Schwachen in Deutschland vor neuer Konkurrenz von außen.[1] Soziale Gerechtigkeit soll sich demnach darin ausdrücken, dass Menschen in Lagern in Nordafrika interniert werden oder im Mittelmeer ertrinken.
Es ist zu begrüßen, dass Wagenknecht und Lafontaine für diesen „sozial gerechten“ menschenverachtenden Zynismus von vielen Seiten kritisiert wurden.
Eines der dabei verschiedentlich gegen die beiden vorgebrachten Argumente scheint mir jedoch verfehlt: Wer den von Lafontaine behaupteten Interessenkonflikt zwischen sozial Schwachen in Deutschland und denjenigen, die neu nach Deutschland kommen wollen, zur bloßen Fiktion erklärt, macht es sich viel zu einfach. Das dadurch konstruierte harmonische Bild, in dem die humanitäre Forderung nach offenen Grenzen in keinerlei Spannung zu den partikularen Interessen innerhalb der Bestandsbevölkerung steht, ist selbst eine linke und liberale Fiktion. Wer ignoriert, dass in der verbreiteten Ablehnung von Migration nicht nur irrationale Angst vor Fremden zum Ausdruck kommt, sondern auch die begründete Angst, relativen Wohlstand teilen zu müssen und mehr Konkurrenz zu bekommen, wird bei der Wahl der Gegenstrategien immer schief liegen.
Das Problem von Lafontaines Positionierung besteht nicht darin, dass er einen Interessenkonflikt konstruiert, wo keiner besteht. Das Problem besteht darin, dass er diesen Interessenkonflikt in einer Weise zur politischen Mobilisierung nutzen will, die sozial Schwache in Deutschland gegen noch Schwächere außerhalb Deutschlands ausspielt. Dies kann im Endeffekt nur zur Verstärkung rassistischer Diskurse und zur weiteren Marginalisierung der Schwächeren beitragen. Es mag sein, dass Die Linke damit ein paar Stimmen von der AfD zurückholen könnte; linke Politik in einem emphatischen Sinne wäre ein solches Nach-unten-Treten aber sicher nicht.
Es stimmt schon, dass es „die Lasten der Zuwanderung […] nicht vor allem denen“ aufgebürdet werden sollten, „die ohnehin bereits die Verlierer der steigenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen sind.“ Eine linke Politik bestünde dann aber nicht darin, Migration zu verhindern und Migrant_innen für soziale Ungerechtigkeit verantwortlich zu machen, sondern darin, etwaige Kosten nach oben zu verteilen, und die Probleme derjenigen, die sich vor Konkurrenz fürchten, zu verbessern.
Das Verhältnis von begründeten Ängsten, unbegründeten Ängsten und Politik habe ich ausführlicher in meinem Aufsatz Angst-Traum „Angst-Raum“. Über den Erfolg der AfD, „die Ängste der Menschen“ und die Versuche, sie „ernst zu nehmen“ diskutiert, der jüngst in einer überarbeiteten Fassung im Forschungsjournal Soziale Bewegungen erschienen (und online frei verfügbar) ist:
Auch in Bezug auf ‚Flüchtlingskrise‘ oder Islam ist nicht jede Angst der ‚Mehrheitsbevölkerung‘ völlig aus der Luft gegriffen. Zwar kann auch massenhafte Einwanderung die ökonomische Lage der Bestandsbevölkerung langfristig verbessern, weil die Binnennachfrage steigt und die Neuankömmlinge zunächst in die niedrig entlohnten Stellen einsteigen, so dass sich für die Bestandsbevölkerung in einem expandierten Arbeitsmarkt Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Da wir nach Keynes‘ bekanntem Diktum jedoch auf lange Sicht alle tot sind, ist es aus der partikularen Perspektive insbesondere unterer Einkommensschichten durchaus instrumentell-rational, wenn sie kurzfristig denken und sich vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sowie einem sich verschärfenden Lohndruck fürchten. Eine ähnliche Konkurrenzsituation existiert auf dem Wohnungsmarkt: Bestand schon vor der ‚Flüchtlingskrise‘ ein Mangel an günstigem Wohnraum in Großstädten, erhöhen die Neuangekommen gerade hier die Nachfrage erheblich, so dass sich die ohnehin angespannte Marktlage nochmals verschärft. Freilich wären für diese Konkurrenzsituationen vernünftigerweise nicht die Geflüchteten, sondern die Wirtschafts- und Wohnungsbaupolitik verantwortlich zu machen, jedoch führt die Zuwanderung tatsächlich zu einer Konkurrenz und somit Verschlechterung für Teile der Bestandsbevölkerung, so dass eine liberale Migrationspolitik nicht in deren partikular-instrumentellem Interesse liegt.
In Bezug auf die Angst vor Islam und Musliminnen ist zwar kaum einzusehen, dass die Abstraktion der Islam eine Bedrohung für die durchschnittlichen AfD-Wählerinnen darstellt; manches, was mit dem Islam in Zusammengang steht, kann jedoch sehr wohl als problematisch gelten. Die vielzitierten Statistiken darüber, welche Todesursachen um ein vielfaches wahrscheinlicher sind als ein Tod durch einen djihadistischen Terroranschlag, können angesichts der jüngsten Massenmorde von Paris, Brüssel, Nizza, Berlin und London nicht darüber hinwegtäuschen, dass islamistischer Terrorismus auch in Mitteleuropa eine reale Bedrohung darstellt. Besonderen Grund zur Furcht haben dabei Jüdinnen. Nicht nur gab es in den letzten Jahren eine ganze Serie von antisemitischen islamistischen Massakern in Europa – Toulouse, Burgas, Brüssel, Paris, Kopenhagen –, auch die antiisraelischen Demonstrationen im Sommer 2014 waren klar islamistisch und antisemitisch aufgeladen (Biskamp 2016a: 13-15). Ebenfalls nachvollziehbar sind feministische Befürchtungen vor einem islamischen Beitrag zu einem kulturellen Backlash, bei dem in den letzten Jahrzehnten erkämpfte Fortschritte rückgängig gemacht werden könnten. Dies ist etwa zu fürchten, wenn Islamverbände, deren Geschlechterpolitik konservativer ist als die der großen christlichen Kirchen in Deutschland (Schrode 2015: 53-57), einen Islamunterricht an deutschen Schulen mitgestalten sollten.
Diese zumindest partikular-instrumentell rationalen oder gar emanzipatorischen Grundlagen für Ängste oder Sorgen dürften einen gewissen Beitrag dazu leisten, dass in der Öffentlichkeit eine massive Fokussierung auf die Themen Flüchtlingspolitik und Islam besteht, was wiederum den Boden für die Angst-Kampagnen der AfD bereitet. Allerdings sollte der rationale Anteil nicht überbewertet werden. Wären die Debatten rational, würde sehr viel mehr über Arbeitsmarktpolitik, Wohnungsbau, Antisemitismus und Geschlechterpolitik im Allgemeinen gesprochen und sehr viel weniger über die gesellschaftlich relativ marginalen Musliminnen und Geflüchteten.
[…]
[Im] positiven Sinne ernst zu nehmen sind die rational begründbaren Ängste vor einer sich zuspitzenden Situation auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt – aber nicht durch Maßnahmen gegen Geflüchtete, sondern durch einen Streit über Wohnungsbau- und Arbeitsmarktpolitik, bei der die verschiedenen Parteien verschiedene Interessen repräsentieren und politisieren.
[1] In einem zweiten, noch weitaus zynischerem Argument, behauptet Lafontaine, dass offene Grenzen sozial ungerecht seien, weil nur die Reichen aus armen Ländern sich die Migration leisten könnten.