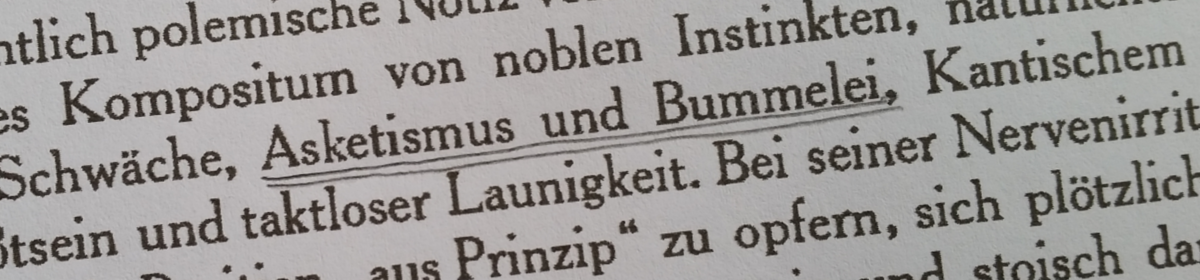Vor zwei Wochen erschien im Online-First/Open-Access-Format der Artikel „The reshaping of political representation in postgrowth capitalism: A paradigmatic analysis of green and right-wing populist parties” von Tilman Reitz und Dirk Jörke. Ich habe ihn gerade gelesen und einige hier spontan aufgeschriebene Anmerkungen.
Reitz und Jörke untersuchen die Transformation der Repräsentationsstruktur in westlichen Demokratien. Ausgangspunkt der Argumentation ist die Annahme, dass wir ökonomisch seit einigen Jahren (oder Jahrzehnten) eine säkulare Stagnation mit anhaltend niedrigen Wachstumsraten erleben. Dies verändere die politische Ökonomie grundlegend – die beiden Autoren sprechen von einem Postwachstums-Kapitalismus (gemeint ist das ökonomische Wachstum, nicht das physische). Das habe für die wirtschafts- und sozialpolitischen Möglichkeiten der Regierungen ebenso deutliche Folgen wie für Klassenstruktur und politische Präferenzen in der Bevölkerung. Gemeinsam führe all dies zu neuen Bedingungen für politische Repräsentation. Auf dieser Grundlage, so die These der beiden, hätten sich zwei Hegemonieprojekte herausgebildet – also gesellschaftlich-politisch-ideologische Projekte, die darum ringen hegemonial zu werden und so den Neoliberalismus zu beerben, der den Keynesianismus beerbte. Auf der einen Seite stehe ein „radikal universalistisches“ Projekt, das von einem progressiven Selbstverständnis geprägt sei und versuche, den Postwachstums-Kapitalismus postmaterialistisch-ökologisch zu verwalten – paradigmatische Beispiele seien Die Grünen in Deutschland, die Demokratische Partei in den USA und Macron in Frankreich. Auf der anderen Seite stehe ein „rechtspopulistisches“ bzw. „national-populistisches“ bzw. „populistisch-autoritäres“ Projekt, das die Vorzüge der industriellen Vergangenheit durch nationalistische Mobilisierung und Exklusion zumindest für die „eigene“ Gemeinschaft erhalten wolle – paradigmatisch seien rechtspopulistische Parteien bzw. Plattformen. Das erstere Projekt verspreche eine universalistisch-grüne Zukunft, ignoriere dabei aber, dass Teile der Bevölkerung in „rauchenden Schloten“ nicht einfach nur rückschrittlichen Schmutz, sondern (aus guten Gründen) auch die Basis für ihre Lebensweise und ihren relativen Wohlstand sähen. Das letztere Projekt setze gerade auf die Mobilisierung dieser Gruppen, könne damit aber die akademischen Mittel- und Oberklassen nicht ansprechen.
Überzeugend an dieser Konzeption ist vor allem, dass sie die relevanten Ebenen verbindet: den Stand kapitalistischer Akkumulation, wirtschafts- und sozialpolitische Programme, die Auswirkungen auf die Klassenstruktur, die sich daraus ergebenden Präferenzen in der Bevölkerung und die damit einhergehenden Möglichkeiten politischer Repräsentation und Hegemoniebildung. Damit vermeiden Reitz und Jörke zwei abgegriffene und unproduktive Klischees. Erstens vermeiden sie die Entgegensetzung von „kulturellen“ und „ökonomischen“ Faktoren als Erklärungen für den Aufstieg des populistischen Rechtsradikalismus; die Abgrenzung gegen diese Entgegensetzung vollziehen die beiden explizit (wobei auch die Abgrenzung mittlerweile so oft bemüht wurde, dass sie fast selbst ein Klischee ist, richtig bleibt sie trotzdem). Zweitens wärmen sie (zum Glück) nicht nochmals die These auf, es gebe eine „neue Spaltungslinie“ zwischen „Kosmopolitismus“ und „Kommunitarismus“; hierzu verhalten sich die beiden nicht explizit und einige der im Folgenden benannten Kritikpunkte hängen damit zusammen, dass sie dieser These meines Erachtens noch zu nahe stehen. Allerdings bemühen sie immerhin nicht diese Begriffe mit ihren falschen Implikationen – und während „dem Kosmopolitismus“ sonst vorgeworfen wird, er ignoriere Ansprüche auf Umverteilung innerhalb des Staates, findet sich bei Reitz und Jörke (zumindest als Andeutung) die deutlich plausiblere These, der „radikale Universalismus“ befürworte zwar „Generösität“ für alle Schwachen und Ausgeschlossenen, unterschätze aber die realen Kosten, die dies in der Umsetzung bedeuten könne.
Daher sollte der Ansatz des Textes unbedingt weitergedacht werden, wobei ich aber auch sieben Kritikpunkte oder Vorbehalte habe:
Erstens stellt sich die Frage, wie stabil ein Postwachstums-Kapitalismus im Sinne des Textes überhaupt sein kann. (Nochmals: Es geht hier um Kapitalismus ohne nennenswertes Wirtschaftswachstum, nicht aber um die Frage, ob es einen „grünen“, also ökologisch nachhaltig wachsenden Kapitalismus geben kann.) Damit Kapitalismus existieren kann, muss Kapital profitable Investitionsmöglichkeiten finden – sonst gäbe es schlichtweg keine Investitionen. Wenn es aber kein oder nur sehr geringes Wachstum gibt, können Profite nur in einem „räuberischen“ Nullsummen-Modus erwirtschaftet werden, also auf Kosten von Wohlstandseinbußen anderer – seien es andere Firmen, andere Sektoren, andere Klassen oder andere Länder (das ist nicht identisch mit der „normalen“ Mehrwertabschöpfung, die prinzipiell auch mit einem absoluten Wohlstandsgewinn auf allen Seiten verbunden sein kann). Dabei mag man sich durch einige Mechanismen „Zeit kaufen“, aber vieles spricht für eine Endlichkeit solcher Chancen. Dieses Problem und seine politischen Implikationen scheinen im Text von Reitz/Jörke etwas unter-, bzw. die politische Handhabbarkeit überschätzt zu werden – denn wie sich unter solchen Bedingungen eine stabile Hegemonie herausbilden sollte, ist rätselhaft.
Zweitens wirkt die Konzeptualisierung des Zusammenhangs zwischen Wachstumsraten, Klassenstruktur und politischen Präferenzen im Artikel zu holzschnittartig. Folgt man dem Artikel bringen die Veränderungen des Kapitalismus genau zwei Arten von Präferenzen hervor: Solche, die sich für ein kulturell progressives, universalistisches, grünes Projekt gewinnen lassen (insbesondere bei den oberen und mittleren Klassen mit Universitätsabschluss) und solche, die sich für ein national-populistisches Projekt gewinnen lassen (insbesondere bei den unteren und mittleren Klassen ohne Universitätsabschluss). Das wird der realen Ausdifferenzierung der Klassenstruktur und den damit verbundenen Präferenzen kaum gerecht – auch nicht als Heuristik. Vor allem geht in der Binarität die sehr weit verbreitete zentristische Präferenz für ein einfach nur irgendwie ordentliches und stabiles Management von Krisen unter.
Drittens ist die Betrachtung der Präferenzen bzw. politischen Positionen durch zweifelhafte Engführungen geprägt. Im üblichen zweidimensionalen Modell gibt es eine soziokulturelle GALTAN-Achse (grün-alternativ-libertär vs. traditionell-autoritär-national) und eine soziökonomische Achse (umverteilend-staatsinterventionistisch vs. marktliberal). Die Autoren verbleiben im Wesentlichen in diesen Kategorien – oder lassen die Zweidimensionalität sogar in Eindimensionalität kollabieren, weil sie die ökonomische Achse kaum ansprechen. Dadurch kommt es zur Engführung verschiedener Präferenzen, deren Korrelation theoretisch nicht notwendig und empirisch nur teilweise haltbar ist. Beispielsweise spricht heute viel dafür, dass Einstellungen in Hinblick auf Migration und Einstellungen in Hinblick auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften unabhängig voneinander sind. Dass eine Befürwortung aktiver Klimaschutzpolitik mit einem von beidem korreliert, sollte ebenfalls nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden. Im Text werden die Offenheit für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die Offenheit für Migration und eine Befürwortung von aktivem Klimaschutz aber recht unterschiedslos als Erscheinungsformen „universalistischer“ Haltungen angesprochen. Dieses Zusammenfallen wäre erst noch zu zeigen. Einige Autor_innen gehen zuletzt eher von drei Dimensionen aus (Beispiel 1, Beispiel 2). Modelle müssen vereinfachen und die Ausdifferenzierung möglichst vieler Dimensionen ist kein Beleg für ein besonders gutes Modell (im Gegenteil!) – wenn bei der Vereinfachung aber wichtige Differenzen unter den Tisch fallen und dadurch Sinn induziert wird, ist das ein Problem.
Viertens ist die Benennung des einen Hegemonieprojekts als rechtspopulistisch, nationalpopulistisch oder populistisch-autoritär zwar plausibel, die des anderen als „radikal universalistisch“ jedoch nicht. Denn mit welcher Begründung wäre der Universalismus von Grünen, Macron und Dems als „radikal“ zu bezeichnen? Ein radikaler Universalismus sollte doch wohl zumindest einen gleichen, von der Nationalität unabhängigen Anspruch aller Menschen auf ein Leben in Würde voraussetzen. Jedoch stehen weder Grüne noch Macron noch Dems für eine Abschaffung von Grenzen bzw. freie Migration ein, sondern allenfalls für eine irgendwie weniger offensiv inhumane Durchsetzung der Grenzregimes (Abschiebung ja, aber bitte schweren Herzens mit humanitären Tönen und ohne Kinder in Käfigen). Das kann man so für richtig oder alternativlos halten, aber ist es radikal universalistisch? Auch in Bezug auf die Klimapolitik kann nur bedingt von Radikalität gesprochen werden. „Linksliberalismus“ oder auch „kulturell progressiver Liberalismus“ träfe das Programm dieser Parteien wohl eher – und weil es ein Liberalismus ist, spiegeln sich in diesem Projekt die Widersprüche, die Liberalismus in seiner gesellschaftlichen Realisierung immer mit sich bringt. Mit einer solchen Bezeichnung würde man auch eher der Tatsache gerecht, dass diese Programme in ihrer humanitären Rhetorik nicht ganz widerspruchsfrei und aufrichtig sind – wie die Autoren zu Recht betonen.
Fünftens verbinden Reitz und Jörke allzu geschmeidig zwei Konzeptionen, die nur bedingt zusammenpassen: Einerseits beschreiben sie einen Prozess politischer Polarisierung, andererseits einen Prozess (versuchter) Hegemoniebildung. Jedoch ist politische Polarisierung das direkte Gegenteil von Hegemoniebildung – im einen Fall treten die jeweiligen Konflikte besonders offen zutage, im anderen werden sie stumm und still. Zwar ist es kein logischer Widerspruch zu sagen, dass eine politische Polarisierung zwischen zwei Projekten besteht, die beide Hegemonie anstreben. Jedoch führt die gleichzeitige Aufrufung des Polarisierungs-Topos und des Hegemonie-Topos im Text zu einer verzerrten Wahrnehmung: Aufgrund der Polarisierungs-Logik werden jeweils die radikaleren Fraktionen der Projekte als paradigmatisch benannt, aufgrund der der Hegemonie-Logik wird dann unterstellt, sie seien es, die der Hegemonie nahekämen. Wieder gerät dabei aus dem Blick, dass radikale Projekte jedweder Art gerade denkbar weit von Hegemonie entfernt sind, weil sie sich hintenanstellen müssen, solange es eine viable zentristische Option gibt – ein bisschen ökologisch, ein bisschen sozial, ein bisschen emanzipativ (solange es keine Kosten verursacht), ein bisschen humanitär, ein bisschen patriotisch, ein bisschen auf Erhaltung des Bestehenden setzend, ein bisschen das Wachstum garantierend, ein bisschen Menschen an den Grenzen und auf den Intensivstationen sterben lassend. Diese zentristische Politik bleibt dabei stets linken (auch radikal-universalistischen) und rechten (auch national-populistischen) Kritiken ausgesetzt.
Sechstens folgt aus allem bisher gesagten eine Vermutung: Womöglich müssen sozialwissenschaftliche Analysen der Repräsentationsstrukturen in westlichen Wohlfahrtsstaaten sehr viel unspektakulärer und auch kleinteiliger ausfallen, als sie das in der Regel tun und darauf verzichten, die eine neue Spaltungslinie, die eine neue Polarisierung, den einen neuen Hegemoniekampf zu diagnostizieren – auch auf die Gefahr hin, dass sich das Ergebnis dann nicht sehr interessant liest.
Siebtens sei noch ein für die Argumentation nebensächlicher, für das Verständnis rechtsradikaler Ideologie aber zentraler Punkt genannt. Wenn Reitz und Jörke eine Deradikalisierung von Rechtsaußenparteien beschreiben, nennen sie unter anderem einen Verzicht auf offenen Rassismus und eine Ersetzung von antisemitischen durch anti-islamische Haltungen. Richtiger wäre es zu sagen, dass der offene (biologistische) Rassismus (unter anderem) durch anti-muslimische Haltungen ersetzt wird, der manifeste (offen antijüdische) Antisemitismus durch Verschwörungsdenken.
Die in der Praxis entscheidende Herausforderung benennen Reitz und Jörke zum Schluss: „As long as a modernized would-be responsible capitalism offers no meaningful occupation for large parts of the population, all appeals to humanity will meet resistance at home.” In einem Postwachstums-Kapitalismus ist das schlichtweg unmöglich – hier kann es nur Verteilungskämpfe im Nullsummenmodus geben. Das belässt genau drei Möglichkeiten: erstens die im Beitrag beschriebenen konkurrierenden Formen der politischen Organisation dieser Verteilungskämpfe, zweitens die Erschaffung eines „grünen“ Wachstumsmodells, drittens eine Zukunft ohne Kapitalismus – halbwegs realistisch und erstrebenswert erscheint nur die zweite Variante.