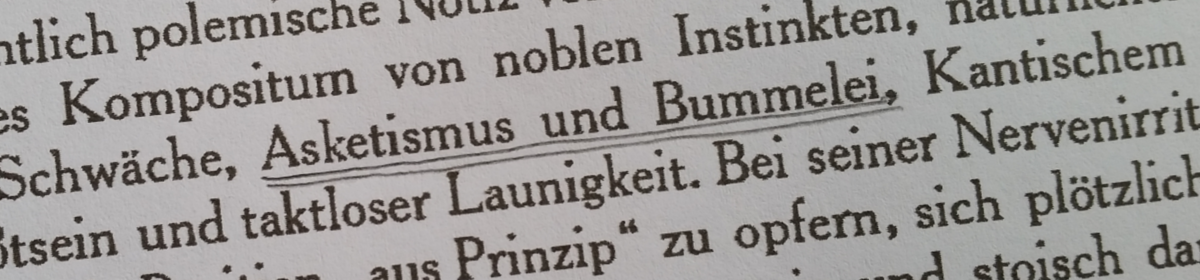In diesem Vortrag widme ich mich einer Argumentationsfigur, in der restriktive migrationspolitische Maßnahmen durch einen Verweis auf die erfolge extrem rechter oder, wie es dann oft heißt, populistischer Parteien gerechtfertigt werden. Diese Art der Umweg-Argumentation findet sich in Politik und öffentlichem Diskurs immer wieder: Eigentlich würde man ja gerne mehr notleidende und flüchtende Menschen aufnehmen; aber wenn man dies täte, dann stärke das nur die AfD, weshalb man – schweren Herzens! – darauf verzichte.[1]
Diese Art der Argumentation ist abgeschmackt und unredlich. Man mag ja argumentieren, dass ein einzelnes Land nur eine irgendwie zu begrenzende Zahl von Menschen aufnehmen kann und die Verantwortung für die Menschenrechte Anderer irgendwo an eine Grenze stößt. Man kann auch versuchen darzulegen, dass diese Grenze nun erreicht sei. Dann soll man diese Argumentation, in der Güter wie Souveränität, Stabilität und der eigene Wohlstand die Menschenrechte anderer übertrumpfen, jedoch bitte offen und explizit führen. Man soll sich aber nicht hinter irgendwelchen „Populisten“ verstecken, die so argumentierten und deren Argumentation man folgen müsse, weil man sie sonst stärken würde.
Im Folgenden zeige ich auf, dass sich diese Argumentationsfigur auch in der wissenschaftlichen Literatur existiert. Dabei beziehe ich mich insbesondere auf zwei Bücher, nämlich auf Philip Manows Politische Ökonomie des Populismus sowie auf Cornelia Koppetschs Gesellschaft des Zorns. In die Argumentation dieser Bücher, die in erster Linie auf den Populismus bzw. die extreme Rechte zielt, ist eine migrationspolitische Argumentationsfigur eingelassen.
Diese migrationspolitische Argumentation verläuft in drei Schritten. Der erste Schritt besteht in der Forderung, die Wähler_innen der AfD als rationale Subjekte ernstzunehmen oder – was damit nicht identisch, aber doch verwandt ist – ihnen empathisch gegenüberzutreten. Dabei werden die AfD-Wähler_innen als ein „Unten“ konstruiert, das gegen ein allzu arrogantes „Oben“ in Schutz genommen wird, dem sich die meisten Leser_innen schuldbewusst zurechnen dürfen. Im zweiten Schritt werden dann die Gründe rekonstruiert, aus denen sich Wähler_innen für die AfD entscheiden, wobei die Ablehnung von Globalisierung und „Kosmopolitismus“ im Allgemeinen sowie die von Migration im Besonderen zentral seien. Zusammengenommen legen diese beiden Schritte nahe, dass es nachvollziehbare und rationale Gründe gegen Migration gibt – schließlich sind es rationale Subjekte, die sie aus empathisch nachvollziehbaren Gründen ablehnen. Daraus wiederum wird im dritten Schritt die These, dass Migration vernünftigerweise zu begrenzen ist. Diese Begrenzungsforderung wird als Weg der goldenen Mitte artikuliert, der zwischen den dann doch etwas übertriebenen Schließunsgforderungen der radikalen Rechten und den ebenso übertriebenen Offenheitsforderungen der kosmopolitischen Eliten verortet ist.
Mit dieser Argumentation, in der die Bedürfnisse der AfD-Wähler_innen als Proxy fungieren, wird, so meine These, ein normatives Dilemma umgangen, das sich argumentativ nicht befriedigend bearbeiten lässt, nämlich das bekannte Problem der Rechtfertigung nationaler Grenzen. Im Folgenden skizziere ich zunächst dieses Dilemma, vollziehe danach die bereits erwähnten drei Schritte des in den Populismusdiskurs eingelassenen Migrationsdiskurses nach und formuliere schließlich einige Schlussfolgerungen.
Inhalt
1 Das Dilemma der Grenze
Politische Institutionen sind grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig – und dies gilt umso mehr für Institutionen, die die Freiheit von Menschen einschränken. Nationale Grenzen zählen heute eindeutig zu diesen freiheitsbeschränkenden Institutionen. Schließlich besteht ihre Funktion nicht zuletzt darin, dass staatliche Autoritäten darüber entscheiden, wer sich auf welchem Fleck der Erde aufhalten darf und wer nicht. Und aufgrund der massiven Ungleichverteilung von Wohlstand und Sicherheit hat das Nichtaufhaltendürfen potenziell tödliche Folgen.
Nähme man universalistische Normen, denen zufolge alle Menschen gleich an Rechten und Würde geboren und entsprechend zu behandeln sind, wirklich ernst, müsste man sich diesen Institutionen gegenüber wohl als Staatsfeind_in verhalten. Anstatt zu schlafen, müsste man die Nächte damit verbringen, die europäischen Grenzen zu sabotieren. Doch anscheinend meint es kaum jemand so ernst, denn kaum jemand betätigt sich in dieser Weise als Staatsfeind_in.
Real dürften die Gründe, aus denen wir alle so viel Zeit mit Schlafen und so wenig Zeit mit Sabotage verbringen, ganz und gar unglamouröser Natur sein. Es wäre einfach anstrengend, entbehrungsreich und gefährlich, sich in dieser Weise zu betätigen. Viel angenehmer ist es, in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur darüber zu referieren und räsonieren.
Auch wenn die wirklichen Gründe so unglamourös sein mögen, kann man durchaus entsprechende normative Argumente vorbringen. Die meines Erachtens plausibelste Argumentation, um den Verzicht auf Staatsfeindlichkeit normativ zu begründen, lässt sich in Anschluss an Hannah Arendt und das „Recht, Rechte zu haben“ formulieren. Wie Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft darlegt, kann man Menschenrechte zwar als universell geltend behaupten, reales Gewicht haben sie aber nur im Kontext konkreter politischer Ordnungen und Gemeinschaften. Und diese politischen Ordnungen haben – bis dato und auf absehbarer Zeit – Grenzen.
Dieses Argument lässt sich mit Seyla Benhabibs Die Rechte der Anderen noch etwas erweitern: Wenn man neben der Menschenrechtsprinzip auch das Demokratieprinzip gelten lässt – und wer täte das nicht? – muss man definieren, wer nun Teil des Demos ist, das sich da selbst regiert. Und dieses sich selbst regierende Demos muss dann eben auch darüber entscheiden können, wer Teil von ihm wird und wer nicht.
Eine weitere Stärkung des normativen Arguments für Grenzen lässt sich durch die Einbeziehung sozialer Menschenrechte erreichen. Anders als die Menschenrechte auf körperliche Unversehrtheit oder freie Rede kosten diejenigen sozialen Menschenrechte, die ein gewisses Maß an materieller Absicherung garantieren, Geld – und Geld ist eine begrenzte Ressource. Es ist wissenschaftlich umstritten, ob offene Grenzen wohlfahrtsstaatliche Garantien sozialer Rechte unterminieren, aber die These ist zumindest vertretbar.
Folgt man diesen Argumenten, hat man also gute Gründe, nicht zur prinzipiellen Staatsfeind_in zu werden: Wenn man universelle Menschenrechte und Menschenwürde zur normativen Richtschnur wählt, muss man auch die Existenz von demokratischen Rechts- und Wohlfahrtsstaaten wünschen. Diese wiederum kommen ohne Grenzen nicht aus.
Jedoch reicht auch diese Argumentation lediglich hin, um zu legitimieren, dass überhaupt politische Ordnungen mit Grenzen existieren. Es heißt noch lange nicht, dass jede konkrete Form der Grenzsicherung legitim wäre. Nimmt man die Kriterien, die Benhabib selbst entwickelt, zum Maßstab, wäre das, was im Mittelmeer sowie in den Lagern in Griechenland, den Balkanländern, der Türkei und Libyen geschieht, keinesfalls zu rechtfertigen. Auch wenn man mit Michael Walzer einen ganz anderen Ansatz wählt, der der Rechtfertigung von Grenzen sehr viel positiver gegenübersteht als Benhabibs, scheint es kaum möglich, diese Zustände zu rechtfertigen.
Es ist ja nicht so, dass die Immigration der letzten Jahre die politischen Ordnungen, die Wohlfahrtsstaaten oder die Gesellschaften Europas an irgendeine objektive Grenze der Belastbarkeit gebracht hätte. Die Aufnahme von mehr Menschen scheitert nicht daran, dass der Staat dann gar keine Menschenrechte mehr garantieren könnte. Sie scheitert an einem Mangel an politischem Willen, etwas vom eigenen Wohlstand abzugeben und die Kosten und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, die eine Aufnahme von Flüchtenden kurz- und mittelfristig mit sich bringt.
Ich will die politische Philosophie der Grenze nicht weiter traktieren, denn es geht mir an dieser Stelle nur darum, daran zu erinnern, dass dieses Problem der Rechtfertigung von Grenzen besteht. Ich sehe nicht nur keinen Weg, das genannte Dilemma aufzulösen, ich sehe nicht einmal eine halbwegs befriedigende Art und Weise, sich zu diesem Dilemma zu verhalten.
Meine These ist nun, dass es sich bei Teilen des Populismusdiskurses um eine Art handelt, dieses Dilemma zu umgehen.
2 Die Wähler_innen der AfD als rationale Objekte
Eine zentrale Rolle bei dieser Umgehungsstrategie spielt eine bestimmte Darstellung von Wähler_innen der AfD. Manow und Koppetsch monieren, dass der Diskurs über diese Wähler_innen oft durch Ignoranz und Arroganz geprägt sei. Damit folgen die beiden anderen Autor_innen wie Bernd Stegemann und Andreas Nölke, die ähnliches schon länger problematisieren. Die Wähler_innen der Rechten würden im Alltagsdiskurs, in der medialen Darstellung, im politischen Diskurs, aber auch in der Wissenschaft degradiert, paternalisiert und pathologisiert. Durch diese abwertenden Diskurse sei man nicht nur außerstande, die Bedingungen für den Aufstieg der AfD wirklich zu verstehen, man verstärke die dem Aufstieg zugrundeliegenden Gefühle von Entfremdung, Degradierung und Spaltung immer weiter.
Stattdessen plädieren Manow und Koppetsch dafür, die Wähler_innen der AfD ernst zu nehmen. Dies tun sie jeweils auf eine etwas andere Weise.
Manow setzt eher rationalistisch an und sucht vor allem nach ökonomisch-rationalen Motiven. Dabei interpretiert er Populismus insgesamt als einen ökonomisch rationalen Protest gegen Globalisierungsfolgen. Weil diese Globalisierungsfolgen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausfielen, nehme auch der Protest jeweils spezifische Formen an.
In den Ländern des europäischen und globalen Südens sei eher die Globalisierung des Warenverkehrs problematisch. Diese gefährde Arbeitsplätze bzw. ganze ökonomische Wachstumsmodelle und werde von den betroffenen Gruppen abgelehnt. Solcher Protest artikuliere sich linkspopulistisch. In den Ländern Nord- und Mitteleuropas stelle sich die Lage anders dar. Hier werde eher die Globalisierung des Faktors Arbeitskraft – vulgo: Migration – von einigen Bevölkerungsgruppen als ökonomische Bedrohung wahrgenommen. Daher artikuliere sich der Protest rechtspopulistisch.
Koppetsch legt weitaus weniger Wert auf Rationalität als Manow, ja sie grenzt sich von allzu rationalistischen Ansätzen sogar entschieden ab: Die Tendenz, hinter jeder politischen Dynamik ökonomische Interessen zu vermuten, sei ein für linke Sozialwissenschaftler_innen typischer Bias, der den Blick auf die Realität verstelle. Stattdessen plädiert sie für eine Methode, die sie als „theoriegeleitete Empathie“ bezeichnet. Ihr geht es zunächst darum, die Weltbilder der Rechten verstehend zu rekonstruieren. Jedoch wirft sie die Frage der Rationalität nicht einfach subjektivistisch über Bord. Nachdem die subjektiven Weltbilder der Rechten rekonstruiert seien, gehe es darum sie zu prüfen, also zu sehen, inwiefern die entsprechenden Darstellungen von Gesellschaft soziologisch haltbar seien.
Leider bleibt diese „Prüfung“ in ihrem Buch de facto aus. Egal, wie genau man liest, es bleibt unklar, in welchen Momenten Koppetsch als Ethnographin das Weltbild der Rechten rekonstruiert und in welchen sie als Sozialstrukturanalytikerin Gesellschaft beschreibt. Das führt dazu, dass sie rechte Ideologie erst empathisch nachfühlt und dann soziologisch verdoppelt, statt sie wie behauptet zu „prüfen“. Im Ergebnis erscheint die Weltsicht der Rechten damit auch als rational rechtfertigbare Perspektive, die sich im weitgehenden Einklang mit soziologischer Forschung befindet.
3 Migration betrachtet durch die Augen von AfD-Wähler_innen
Auch in Bezug auf die Rolle, die der Frage von Migration zukommt, unterscheiden sich die beiden Bücher zunächst stark, kommen sich im Ergebnis aber doch wieder recht nahe.
In Manows Darstellung ist Migration die Hauptursache für den Aufstieg der Rechten. Sie bedrohe den ökonomischen Status ganzer Gesellschaftsgruppen, die sich durch eine Unterstützung der Rechten und eine Forderung nach einer restriktiveren Einwanderungspolitik dagegen wehrten. Dabei unterscheide sich die Art der Bedrohung je nach Typus des Wohlfahrtsstaates und des Arbeitsmarktes. In den angelsächsischen Ländern mit ihren offenen Arbeitsmärkten und rudimentären Wohlfahrtsstaaten werde vor allem Arbeitsmigration zum Problem: Die Arbeitsmigrant_innen würden als gefährliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen. In den kontinentalen Ländern Mittel- und Nordeuropas mit ihren eher geschlossenen Arbeitsmärkten und großzügigeren Wohlfahrtsstaaten, werde dagegen eher Fluchtmigration zum Problem: Die Geflüchteten würden als Belastung der Wohlfahrtsstaaten wahrgenommen. Das Problem spitze sich dadurch zu, dass die Länder jeweils die Art von Migration anzögen, die für sie besonders problematisch sei – eine argumentative Volte, die einer eigenen Kritik bedürfte.[2]
Die These, dass der Aufstieg der Rechten in erster Linie eine Reaktion auf Migration sei, reizt Manow sehr weit aus und führt selbst noch die jüngeren Wahlsiege der ungarischen Fidesz und der polnischen PiS auf den Sommer der Migration 2015 zurück – obwohl diese Länder ökonomisch sehr viel stärker durch Emigration als durch Immigration geprägt sind, Flucht-Immigration hier fast keine Rolle spielt.
Koppetschs Herangehensweise unterscheidet sich von Manows in zwei grundlegenden Punkten: Erstens betont sie, dass es beim Aufstieg der AfD primär gerade nicht um ökonomische Bedrohung, sondern um symbolische Abwertung gehe: Zur AfD tendierten Milieus, die in den letzten Jahrzehnten eine relative Degradierung erfahren hätten. Gesellschaftliche Transformationsprozesse hätten dazu geführt, dass heute andere Kompetenzen und Werte gälten als im Fordismus. Heute zählten Flexibilität, Offenheit und Vielfalt. Diejenigen Milieus, die eher Werte von Bodenständigkeit, Verlässlichkeit und Disziplin verträten, sähen sich durch diese Veränderung abgewertet. Dies gelte für konservative und statusbewusste Oberschichtmilieus, für verunsicherte traditionsbewusste Mittelschichtmilieus sowie für autoritäre und prekäre Unterschichtmilieus. Aus dieser Abwertung erwachse ein Ressentiment gegen die entsprechenden Transformationsprozesse und die kosmopolitischen Milieus, die davon profitierten.
Damit ist auch der zweite Unterschied zu Manow bezeichnet: Migration zählt in Koppetschs Darstellung nicht zu den Hauptursachen für den Aufstieg der Rechten. Gleichwohl werde sie sehr relevant. Dies geschehe dadurch, dass sich die „Sozialfigur des Migranten“ besonders gut eigne, um die Abstiegserfahrungen und Ressentiments gegen den Kosmopolitismus auszuagieren.
4 Eine restriktivere Migrationspolitik als Weg der goldenen Mitte
Wenn nun rationale Subjekte, denen man mit Empathie begegnen soll, sich mit nachvollziehbaren Gründen gegen Migration aussprechen, folgt daraus dann nicht, dass es einer restriktiveren Migrationspolitik bedürfe, diese vernünftig sei? Um zu diesem Schluss zu kommen, muss man noch einige argumentative Lücken überbrücken.
Wie das geschieht, kann man gut an Manows begeisterter FAZ-Rezension von Koppetschs Buch ablesen. Allein diese Begeisterung könnte wundern: Schließlich erscheint Koppetschs Buch ziemlich genau ein halbes Jahr nach Manows und ist diesem in den Prämissen geradezu entgegengesetzt. Was die beiden Bücher und Autor_innen verbindet und die Begeisterung erklärt, ist die hier skizzierte Argumentationsfigur: Beide beschreiben eine verbreitete Haltung, verächtlich auf die Wähler_innen der Rechten zu schauen und setzen dem einen Ansatz entgegen, in dem diese Wähler_innen – nicht zuletzt in ihrer Ablehnung von Migration – ernstgenommen werden sollen. Und genau dies hebt Manow in seiner Rezension auch lobend hervor:
„Bei Koppetsch gehört schließlich der in der einschlägigen Literatur eher selten zu findende Hinweis dazu, dass angesichts dieser umfassenden Transformationsprozesse die Anrufung des Protektionistischen und Kompensierenden und Restriktiven des nationalen Wohlfahrtsstaats alles andere als irrational oder unverständlich oder auch nur im Kern unethisch sei.“
Gerade in den letzten Worten werden die argumentativen Sprünge deutlich, auf die es mir ankommt: Das Rationale, das Verständliche und das Ethische werden hier zusammengezogen, als ließen sie sich irgendwie aufeinander abbilden. Das ist aber nicht der Fall.
Erstens wird eine Weltsicht dadurch, dass sie verständlich ist, noch lange nicht rational. Alle möglichen Irrationalitäten lassen sich durch Empathie verstehen. Die Motive für einen im Affekt begangenen Mord können verständlich sein, aber dadurch werden sie nicht rational. Dem Eindruck, dass die Weltsicht der AfD-Wähler_innen rational sei, leistet Koppetsch dadurch Vorschub, dass sie behauptet, diese zu „prüfen“, die Prüfung aber faktisch unterlässt.
Zweitens wird eine Haltung dadurch, dass sie verständlich und rational ist, noch lange nicht ethisch legitim. Die Motive eines aus Habgier begangenen Mordes können verständlich und rational sein, aber das heißt nicht, dass sie nicht unethisch wären. Instrumentelle Rationalität und praktische Vernunft sind nicht eins.
Freilich behauptet Manow im zitierten Satz nicht, dass Verständlichkeit, Rationalität und Ethik eins seien, aber er zieht es zusammen – was gerade vor dem Hintergrund irritiert, dass ethische Fragen weder in seinem Buch noch in dem von Koppetsch ernsthaft diskutiert werden.
Bezogen auf Migrationspolitik: Ist es verständlich, dass Menschen, die seit 30 Jahren an einem fort hören, dass der Wohlfahrtsstaat nicht mehr zu finanzieren sei und alle den Gürtel enger schnallen müssten, irritiert reagieren, wenn es nun reicht, einige hunderttausend Menschen aufzunehmen, die zumindest übergangsweise auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen angewiesen sind? Ja, das ist es. Ist es instrumentell rational, wenn sich diejenigen Gruppen gegen Immigration aussprechen, die befürchten müssen, dass sich ihre Position auf dem Arbeitsmarkt dadurch verschlechtert? Auch wenn die realen Arbeitsmarkteffekte von Immigration umstritten sind, könnte man auch diese Frage bejahen. Wird es dadurch ethisch, eine restriktive Migrationspolitik zu vertreten, wenn diese für die Menschen an den EU-Außengrenzen die Folgen hat, die sie hat? Ich sähe nicht wie. Es bleibt ein Nach-unten-Treten mit tödlichen Folgen.
Aber genau auf eine solche migrationspolitische Forderung läuft es hinaus. Auf der vorletzten Seite von Koppetschs Buch – und somit an rhetorisch gewichtiger Stelle – heißt es:
„Heute dagegen wird sichtbar, dass über das Schicksal des westlichen Liberalismus und die Entwicklung Europas im 21. Jahrhundert nicht mehr allein der Westen, sondern die Aufnahme der legal oder illegal in die Europäische Union kommenden Migranten bestimmen könnte (Krastev 2017). Problematisch an der bisherigen politischen Konzeption der Bewältigung der sogenannten Flüchtlingskrise war nicht nur, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 sich zur Bewältigung als ungeeignet erwies, problematisch war vor allem die mangelnde Bereitschaft der bürgerlichen Parteien, die Migration und deren Folgen zum Gegenstand einer öffentlichen politischen Auseinandersetzung zu machen und an deren Stelle die bloße Behauptung zu setzen, die Politik der Grenzöffnung sei für alle Beteiligten von Vorteil (eine ›Win-win-Situation‹). Dies war ein zentraler Auslöser für den Wandel der politischen Landschaft und eine Ursache dafür, dass der Liberalismus in den Augen mancher als heuchlerisch erscheint.
Mittlerweile bezweifeln auch Liberale, dass es möglich ist, alle Asylsuchenden aufzunehmen und gesellschaftlich zu integrieren – allerdings sind ihre Schlussfolgerungen andere. Rechte Parteien behaupten, die wohlhabenden Länder hätten das Recht, ihre Lebensweise zu verteidigen und die Flüchtlinge abzuweisen, und betreiben somit eine offensive Selbstethnisierung westlicher Werte. Demgegenüber sind Liberale in dem Dilemma gefangen, dass sich die von ihr behauptete universelle Geltung der Menschenrechte nicht mit den eigenen exklusiven Privilegien in wohlhabenden Gesellschaften vereinbaren lassen. Die Migrationskrise in Europa ist somit ein Wendepunkt für die Erarbeitung einer neuen Sicht auf die westliche Welt, die deutlich macht, dass westliche Lebensformen und Gesellschaftsbilder eine neue Partikularität erlangt haben, durch die sie in Konkurrenz zu anderen Gesellschaftsordnungen treten.“ (Koppetsch 2019: 257, Hervorhebungen F.B.)
Zunächst ist freilich festzuhalten, dass es bereits ein sehr eigenwilliger Blick auf die Genfer Flüchtlingskonventionen ist, wenn man fragt, ob diese sich zur „Bewältigung“ von Flüchtlingskrisen eignen. Aber auch sonst bleibt vieles zweifelhaft. Wann haben welche Liberalen in Deutschland gesagt, dass es möglich ist, alle Asylsuchenden aufzunehmen und gesellschaftlich zu integrieren? Wer sind alle Asylsuchenden? Und welche Liberalen sind es, die nun daran zweifeln? Koppetsch lässt es offen.
Was am Ende bleibt, ist die rhetorische Figur der goldenen Mitte: Auf der einen Seite steht ein nicht durchhaltbarer Menschenrechtsliberalismus, auf der anderen Seite eine offensive Selbstethnisierung. Dazwischen soll nun eine Position stehen, die einen Kompromiss zwischen Privilegienerhaltung und Menschenrechten findet, indem sie die Universalität der letzteren opfert. Was hier als westliche Bescheidenheit formuliert ist, heißt in der Folge wohl, dass sich die Menschen in den Lagern in Griechenland, den Balkanländern, der Türkei, Syrien und Libyen nicht auf Menschenrechte berufen können. Ähnliche Motive der goldenen Mitte finden sich auch bei Andreas Nölke oder Wolfgang Merkel und Michael Zürn. Der Mittelweg soll in einem Ausgleich zwischen den Ansprüchen des Grenzschutzes und der Humanität bieten.
Eine solche Forderung nach einer etwas restriktiveren Migrationspolitik als Forderung der goldenen Mitte macht freilich nur Sinn, wenn man unterstellt, dass die Migrationspolitik der letzten Jahre durch zügellose Grenzöffnung gekennzeichnet gewesen wäre. Schaut man sich aber die Realitäten an den europäischen Außengrenzen an, stellt man einerseits fest, dass von einer Offenheit der Grenzen keine Rede sein kann und die Humanität, sehr euphemistisch formuliert, begrenzt ist. Wie nun eine Revision in Richtung einer restriktiveren Politik noch Raum für Humanität lassen oder eine goldene Mitte darstellen soll, ist rätselhaft.
5 Fazit
Ich will die Argumente von Koppetsch und Manow wohlgemerkt nicht in toto zurückweisen: Ja, man sollte die Wähler_innen der AfD als politische Subjekte ernstnehmen – was sollte man auch sonst tun? Ja, die Ablehnung von Migration ist eine Hauptmotivation dieser Wähler_innen. Und ja, die Frage der Migration stellt sich für prekäre Milieus mit niedrigem Bildungsstatus anders als etwa für Journalist_innen und Wissenschaftler_innen. Die letzteren müssen kaum einen Statusverlust aufgrund von Migration befürchten, die ersteren durchaus.
Das ist ethisch nicht folgenlos. Es bedeutet insbesondere, dass die abgesicherten Kommentator_innen im öffentlichen Diskurs nicht leichtfertig über die Haltungen der weniger abgesicherten Gruppen urteilen sollten. Tatsächlich könnte man über diese selbstgerechten Kommentator_innen einen ähnlichen Vortrag halten wie diesen: Auch diese umgehen normative Grundprobleme von Migration und Umverteilung, indem sie die Ablehnung von Migration allein auf rassistische Gesinnung reduzieren und die instrumentelle Rationalität herausrechnen.
Aber, und das ist mein zentraler Punkt: Wie auch immer man sich zum Dilemma der Grenze verhält, man sollte es direkt tun. Wer eine restriktivere Migrationspolitik fordert, fordert de facto, dass sich die Situation der Menschen an den EU-Außengrenzen noch weiter verschlechtert. Dies wiederum heißt, dass man Menschenrechte von Nicht-Europäer_innen einschränken will, weil man den Wohlstand und die Souveränität der europäischen Staaten für wichtigere Güter hält. Dazu sollte man sich dann direkt bekennen und nicht die AfD-Wähler_innen als argumentativen Proxy verwenden. Denn auch diese Instrumentalisierung ist kein „Ernstnehmen als politische Subjekte“.
[1] Unterstützend gibt es auch eine europapolitische Umweg-Argumentation: Erst wenn eine gesamteuropäische Verteilungslösung gefunden sei (von der alle wissen, dass es sie nicht geben wird), könne Deutschland aktiv werden.
[2] Es scheint überhaupt nicht plausibel, dass die USA und das UK eher Arbeits- als Fluchtmigration anziehen. Es gibt mehr als genug Flüchtende auf der Welt, die nur zu gern in diese Länder migrieren würden, aber nicht können. Zurückgehalten werden sie weniger durch die rudimentären Wohlfahrtsstaaten als vielmehr durch das diese Staaten umgebende Wasser sowie durch ihre Grenzsicherungsmaßnahmen. Der „Dschungel“ in Calais zeigt dies zu genüge. Es ist weniger so, dass die Staaten jeweils eine bestimmte Form von Migration „anziehen“, vielmehr verwandeln die Staaten dieselben Migrant_innen im Zweifel in die jeweilige Form.