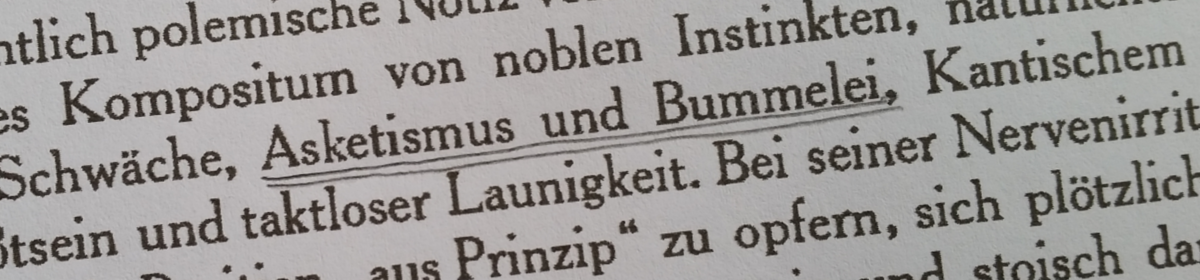Floris Biskamp
Eine Frage, die nicht nur in feministischen und rassismuskritischen Kontexten immer wieder zu Kontroversen führt, ist die nach dem Sprechen über die Geschlechterverhältnisse der (kulturell) Anderen. Insbesondere wird darüber gestritten, unter welchen Bedingungen man eine Darstellung islamischer Geschlechterverhältnisse als Kritik patriarchalischer Herrschaft willkommen heißen und unter welchen Bedingungen als Beitrag zur Stigmatisierung einer Minderheit zurückweisen soll. Weil Gayatri Spivaks Satz „White men saving brown women from brown men” dabei von rassismuskritischer Seite oftmals zitiert wird, um Diskurse als rassistisch auszuweisen, gehe ich diesem Satz in Spivaks Werk nach und rekonstruiere, nach welchen Kriterien sie selbst ihn verwendet. Dabei komme ich zu dem Schluss, dass sie für ihre Urteile eine weitaus aufwändigere Beweisführung leistet, als es in der Rassismuskritik oft üblich ist.
((Drei Tage nach meiner Diskussion mit Sama Maani in Trier habe ich bei der dieses Jahr unter dem Titel „Intersektionale und postkolonial-feministische Perspektiven als Instrumente einer politikwissenschaftlichen Macht- und Herrschaftskritik“ stattfindenden Jahrestagung des AK Politik und Geschlecht in Essen ein Paper über meine Interpretation von Gayatri Spivaks Kritik paternalistischer Rettungsdiskurse präsentier. Meine Argumentation ist dabei komplementär zu der, die ich in Bezug auf Maanis Texte formulierte. Wandte ich mich dort gegen eine „Islamkritik“, die sich allzu sicher darin ist, mit Rassismus nichts zu tun zu haben, lege ich hier unter Rückgriff auf Spivak andersherum dar, dass es sich auch Rassismuskritik nicht zu einfach machen sollte. Bei diesem Blogbeitrag handelt es sich um eine geringfügig erweiterte und überarbeitete Version des Vortragsmanuskripts. Den Entwurf des vollen Papers, das auf Kapitel 5 meiner Dissertation Orientalismus und demokratische Öffentlichkeit beruht und wohl 2018 veröffentlicht wird, teile ich gerne auf Anfrage via E-Mail.))
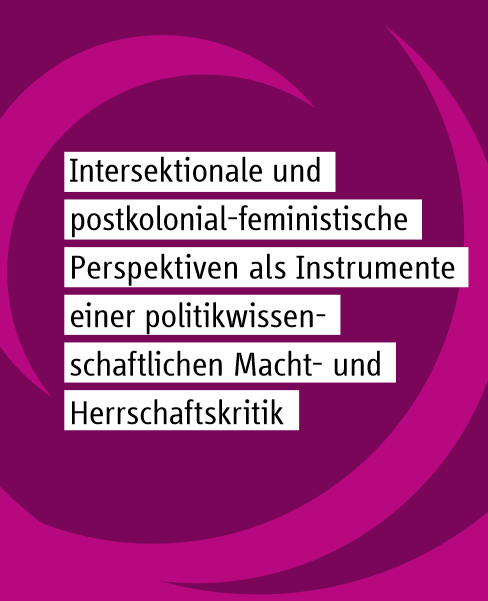
Wenn Darstellungen patriarchalischer Strukturen in islamischen Kontexten als rassistisch zurückgewiesen werden, geschieht dies oft unter Rückgriff auf Gayatri Spivaks vielzitierten Satz: „White men saving brown women from brown men“. Diese etwa in Bezug auf Diskussionen um das islamische Kopftuch zitierte Formel soll darauf verweisen, dass es in den entsprechenden Diskursen nur scheinbar um das Wohlergehen von Frauen und Mädchen gehe, in Wirklichkeit aber darum, ein nichtmuslimisches Wir als zivilisiert, die muslimischen Anderen als barbarisch zu markieren. Diese Kritik soll darauf verweisen, dass die Darstellung muslimischer Frauen und Mädchen als zu rettende Opfer diesen eher schade als nütze. Ich hege keinen Zweifel daran, dass diese Charakterisierung den selbstinteressierten, paternalistischen und durchaus rassistisch zu nennenden Charakter einiger dieser Diskurse sehr gut auf den Punkt bringt.
Jedoch ist damit auch unmittelbar eine Frage aufgeworfen: Wenn man davon ausgeht, dass es Geschlechterverhältnisse wirklich gibt und dass diese in unterschiedlichen kulturellen Kontexten unterschiedliche Formen annehmen, müsste man davon ausgehen, dass die kritische Darstellung kulturell differenter Geschlechterverhältnisse eine nicht nur legitime, sondern wünschenswerte Form von Wissensproduktion sein und befreiende Effekte haben kann: Sie kann Marginalisierungs- und Unterdrückungsverhältnisse sichtbar machen und zu ihrer Abschaffung beitragen. Dann wäre sie nicht paternalistisch, sondern eine Form aktiver Solidarität.
Daher stellt sich die Frage, wie man einer Darstellung ansieht, ob sie nun in diesem Sinne legitim, solidarisch und befreiend oder ob sie illegitim, paternalistisch, selbstinteressiert und im Endeffekt rassistisch ist. Es stellt sich die Frage, wann es sich bei Kritik patriarchalischer Normen in islamischen Kontexten um praktische Solidarität mit den von diesen Normen betroffenen Personen handelt und wann um einen bloßen Beitrag zur Stigmatisierung des Islam und aller als muslimisch identifizierten Personen.
Dies ist wohlgemerkt nicht die Frage, „was man überhaupt noch sagen darf, ohne als rassistisch bezeichnet zu werden.“ Vielmehr ist es die Frage, wie man selbst sinnvollerweise sprechen sollte, wenn man nicht rassistisch sein will, sowie die Frage, wann man das Sprechen anderer Sprecherinnen[1] sinnvollerweise als rassistisch kritisieren sollte.
Zu den Quellen!
In den gegenwärtigen Texten, in denen Spivaks Satz in rassismuskritischer Absicht zitiert wird, nimmt die Reflexion dieser Fragen zumeist wenig oder keinen Raum ein. Daher bietet es sich an, zur Quelle zurückzugehen und zu analysieren, wie Spivak selbst sich hierzu verhält. Dieser Weg liegt auch deshalb nahe, weil Spivak immer wieder explizit betont, dass Darstellungen der Lebens- und Geschlechterverhältnisse in verschiedenen Kontexten ein entscheidender Bestandteil herrschaftskritischer Praxis sind. So formuliert sie programmatisch: „We should […] welcome all the information retrieval in these silenced areas that is taking place in anthropology, political science, history, and sociology“ – dies tut sie wohlgemerkt nicht irgendwo, sondern in eben dem Aufsatz Can the Subaltern Speak?, aus dem auch der vielzitierte Satz über Rettungsdiskurse stammt. Zudem kommt Spivak in ihren eigenen Texten selbst nicht darum herum, kritische Darstellungen von kulturellen Normen vorzunehmen.
Somit ist sie gezwungen, eine Unterscheidung zwischen wünschenswerten und ablehnenswerten Darstellungen von Kultur vorzunehmen. Dabei weist sie zwar nie einen expliziten Kriterienkatalogs aus, performativ und implizit vollzieht sie die Unterscheidung aber sehr wohl auf Grundlage nachvollziehbarer Kriterien, die ich Folgenden herausarbeite.
Dabei beziehe ich mich auf zwei ihrer Aufsätze, in denen Sie Darstellungen von Geschlechterverhältnissen kulturell Anderer kritisiert. Dies ist zum einen Can the Subaltern Speak? (1988, Im Folgenden Subaltern), zum Anderen French Feminism in an International Frame (1981, im Folgenden French Feminism). In Subaltern analysiert Spivak die Diskurse rund um das Verbot der Witwenverbrennung, das die britische Kolonialmacht in Indien verhängte. Entgegen einem weitverbreiteten Missverständnis spricht Spivak sich dabei weder für Witwenverbrennung noch gegen ihr Verbot aus – im Gegenteil kritisiert sie die indisch-nationalistische Verteidigung der Praxis scharf und bezeichnet das Verbot selbst als „in itself admirable“ und später gar als „a good law“. Jedoch vertritt sie die These, dass das Gesetz nicht ernsthaft zur Verbesserung der Situation indischer Frauen beigetragen habe, weil diese gar nicht als Subjekte adressiert oder einbezogen worden seien. Vielmehr seien sie nur als Objekte der Rettung aufgetaucht, um der Kolonialpolitik einen Anschein von Legitimität zu verleihen. Dabei stellt Spivak selbst relativ ausführlich die dogmatische Grundlage der Witwenverbrennung innerhalb der Hindu-Tradition dar, so dass sie ihre eigene Darstellung indischer Kultur von den britisch-kolonialen abgrenzen muss. In French Feminism legt Spivak einen Überblick über den feministischen Diskurs im Frankreich der 1960er und 1970er vor. Dabei widmet sie lange Passagen der Kritik von Julia Kristevas Buch Die Chinesin. Spivak wirft Kristeva vor, die Geschlechterverhältnisse in China zu romantisieren, um ein positives Gegenbild zum patriarchalischen Westen zu schaffen und ihrer eigenen feministischen Position Legitimität zu verleihen – ohne sich für chinesische Realitäten und chinesische Frauen ernstlich zu interessieren. Daher ist diese Kritik eine interessante Ergänzung zu der in Subaltern formulierten.
Das offizielle Kriterium: Der Machteffekt der Darstellung
Was ist nun der Unterschied zwischen einer wünschenswerten und einer abzulehnenden Darstellung von Kultur? Nimmt man das offizielle Programm, das Spivak für ihr Verständnis von Dekonstruktion vorgibt, interessiert sie sich nicht sonderlich für den Wahrheitswert einer Darstellung und ebenso wenig für epistemologische Überlegungen darüber, unter welchen Bedingungen Wahrheit und Erkenntnis in einem emphatischen Sinne möglich sind. Vielmehr geht es ihr um die Frage, wie Wahrheiten produziert werden und wie die Produktion von Wahrheit mit Machtrelationen verbunden ist. Die zentralen Fragen für sie lauten: Wer kann Wahrheiten über wen produzieren? Wer wird gehört und wer nicht? Wessen Identität, wessen Herrschaft, wessen Privilegien, wessen Marginalisierung werden dabei produziert, reproduziert und zementiert, wessen Handlungsfähigkeit erweitert, eingeschränkt oder ausgelöscht?
Das Kriterium, auf das Spivak also letzten Endes zielt, wenn sie legitime von illegitimen Darstellungen unterscheidet, ist also der herrschaftsstabilisierende oder herrschaftsunterminierende Effekt, den die Darstellung hat. Das Problem bei diesem Kriterium ist relativ offensichtlich: Es ist kaum zu operationalisieren. Nur sehr selten kann man den Effekt einer Darstellung oder eines Sprechakts direkt beobachten – und tatsächlich unternimmt Spivak in ihren Texten auch nichts dergleichen. Nirgends nimmt sie tatsächliche Wirkungsanalysen von Texten vor. Daher benötigt sie in ihrer kritischen Praxis beobachtbare Kriterien, die Aufschluss darüber geben, welchen Effekt eine Darstellung von Kultur wahrscheinlich hat.
Relevant aber nicht entscheidend: Die Sprecherinnenposition
Ein im gegebenen theoretischen Kontext naheliegendes Kriterium ist die Positionalität der Sprecherin – und tatsächlich ist dieses für Spivak relevant. So moniert sie sowohl in Bezug auf den britischen Diskurs gegen Witwenverbrennung als auch in Bezug auf den indisch-nationalistischen Diskurs für Witwenverbrennung als auch in Bezug auf Kristevas Diskurs über chinesische Frauen, dass die Stimmen der Frauen, um deren Leben und Wohlergehen es angeblich geht, stumm bleiben.
Jedoch lassen sich auch auf dieser Ebene letztlich keine wirklichen Kriterien zur Unterscheidung von wünschenswerten und ablehnenswerten Darstellungen formulieren. So ist das zentrale Argument von Spivak gerade, dass die Subalternen aufgrund ihrer totalen Marginalisierung nicht effektiv für sich sprechen können, dass aber die Wissensproduktion über Subalternität unbedingt wünschenswert ist. Die Abwesenheit der Stimmen derer, um die es geht, verweist zwar auf ein Problem, sie delegitimiert aber nicht per se die Darstellungen. Das heißt, dass es für Spivak nicht in jedem Falle problematisch, sondern unter Umständen durchaus wünschenswert ist, wenn aus einer privilegierten Position Wissen über marginalisierte Gruppen und die Bedingungen ihrer Marginalisierung produziert wird.
Insbesondere betont Spivak wiederholt in aller Deutlichkeit ihre Ablehnung der These, dass nur die „Angehörigen“ einer Kultur über diese sprechen könnten oder sollten. Sie kritisiert die britischen Kolonialherren und Julia Kristeva nicht einfach dafür, dass sie als Europäerinnen über nichteuropäische Geschlechterverhältnisse sprechen. Sie kritisiert sie dafür, dass sie es in einer bestimmten Weise und in einem bestimmten Kontext tun.
Auch andersherum kann die Anwesenheit von „betroffenen“ Stimmen einen Diskurs oder eine Darstellung nicht per se legitimieren, weil jede Stellvertretung einer Gruppe durch bestimmte Stimmen zwangsläufig Ausschlüsse produziert. Um es am Beispiel „muslimischer Frauen in Deutschland“ zu sagen: Wenn Lamya Kaddor spricht, spricht Kübra Gümüşay nicht. Wenn beide sprechen, spricht Seyran Ateş nicht. Und wenn alle drei sprechen, sprechen immer noch Millionen anderer nicht. Daher ist die Frage, wer über und mit wem spricht, relevant, sie taugt aber nur bedingt als Kriterium für die Legitimität von Darstellungen.
Die Motivation hinter dem Sprechen
Die nächste Ebene, die Spivak überraschenderweise öfter anspricht, ist die Motivation hinter den Darstellungen. Solche Spekulationen über die Intentionen und das Bewusstsein der Sprechenden sind im Kontext der Dekonstruktion im Grunde nicht vorgesehen – laut Friedrich Nietzsche, gewissermaßen der Stammvater der Dekonstruktion, gibt es keinen Täter hinter der Tat. Dennoch tauchen solche Spekulationen insbesondere in French Feminism auf. Spivak wirft Kristeva – und en passant auch fast der gesamten strukturalistischen und poststrukturalistischen Prominenz aus Frankreich – vor, zwar ab und zu über nichtwestliche Kulturen zu sprechen, dabei aber in Wirklichkeit „obsessively self-centered“ zu sein. Diese westlichen Vernunftkritikerinnen beriefen sich nur auf andere Kulturen, um damit der eigenen Kritik westlicher Rationalität zusätzliche Legitimität zu verschaffen.
Mit ihrem Rekurs auf die (bewussten oder unbewussten) Motivationen der Sprecherinnen führt Spivak implizit das Kriterium ein, dass Darstellungen dann legitim sind, wenn ihnen ein wirkliches Interesse an den Anderen zugrunde liegt. Genauer soll dieses legitime Interesse in einem ethischen Impuls bestehen, mit den Anderen in einen verantwortlichen Austausch zu kommen. Hier steht die Levinas’sche Ethik des späten Derrida Patin, so dass es nicht um eine paternalistische Verantwortung für Andere geht, sondern darum, den anderen verantwortlich zu sein. Illegitim sind dagegen Darstellungen, die die Anderen zwar erwähnen, denen in Wirklichkeit aber ein Interesse an der eigenen Identität und Situation zugrunde liegt. Darstellungen die durch ein echtes Interesse an den Anderen motiviert sind, sollen demnach zu einer Ermächtigung der Anderen beitragen, selbstinteressierte Darstellungen nur zur Stärkung der eigenen Identität und Privilegien.
Dieses recht moralisch klingende Kriterium ist durchaus plausibel, jedoch lässt sich die Motivation hinter einer Darstellung letzten Endes fast so schwer beobachten wie der Effekt, den sie zeitigt. Daher führt Spivaks Kritik letztlich noch weiter in den Text hinein, zu den Inhalten der Darstellung.
Der Inhalt der Darstellungen: Fünf Kriterien
In Bezug auf den Inhalt der Darstellungen finden sich bei Spivak insgesamt fünf Kriterien. Das erste ist die Art und Weise, auf die die anderen Frauen dargestellt werden: Erscheinen sie in der Darstellung nur als stumme, entfernte Andere, die beispielsweise Objekt der Rettung sein müssen? Oder als zumindest potenziell sprechende Subjekte, als potenzielle Träger_innen von Agency, mit denen man in einen verantwortlichen Austausch kommen kann und möchte, der aber mithin durch die gegenwärtigen Bedingungen blockiert ist?
Daran an schließt sich zweitens die Frage, wie die Bedingungen dieser Blockade bzw. der Unterdrückung dargestellt werden. Hierbei kann Kultur für Spivak durchaus eine Rolle spielen – tatsächlich formuliert sie einen Kulturbegriff, dem zufolge die Regulierung des Geschlechterverhältnisses ein zentraler Bestandteil von Kultur ist. Jedoch ist es entscheidend, was für ein Verständnis von Kultur dabei zur Anwendung kommt. Spivaks Forderungen sind die zu erwartenden: Kultur soll als dynamisch, fragmentiert und in Wechselwirkung mit Machtverhältnissen dargestellt werden, als ein Prozess der steten Konstruktion, Rekonstruktion, Fixierung und Transformation. Nicht aber sollen Kulturen homogenisierend und essenzialisierend als statische Container dargestellt werden, die gegeneinander abgeschlossen sind.
Daran schließt sich drittens an, dass Kultur zwar als ein Faktor zu thematisieren ist, aber nicht als der einzig relevante. Spivak betont, dass auch andere Faktoren zum Verstummen der Anderen beitragen. Insbesondere fordert sie, dass auch die Faktoren thematisiert werden, an denen die Darstellenden als Komplizinnen beteiligt sind. Besonderen Wert legt sie auf die Thematisierung der internationalen Arbeitsteilung und der damit einhergehenden ökonomische Ausbeutung, aber auch der begleitenden politischen Prozesse. Wenn eine Darstellung die Unterdrückung von Frauen durch die patriarchalische Kultur der Anderen problematisiert, ohne auf transnationalen Kapitalismus, Kolonialismus, postkoloniale Herrschaft und Rassismus einzugehen, zweifelt Spivak daran, dass ein ernsthaftes Interesse an den Anderen vorliegt und ein befreiender Effekt wahrscheinlich ist.
Darauf folgen die wahrhaft überraschenden Kriterien: Beide Texte, die ich analysiere, sind viertens durchzogen von dem Vorwurf, dass die jeweils kritisierten Darstellungen die Realität der Anderen nicht angemessen wiedergeben. So kritisiert sie dir britischen Darstellungen als „skeletal“ und „far off the mark“. Dies steht auf den ersten Blick in einer deutlichen Spannung zu Spivaks eigenen programmatischen Aussagen, denen zufolge es bei Dekonstruktion nicht um die Korrektur von Fehlern gehe. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass Spivak in dieser Frage durchaus konsequent ist. Sie kritisiert die Darstellungen nicht, weil sie falsch sind und durch richtigere Darstellungen ersetzt werden sollten. Jedoch ist sind bestimmte sachliche Fehler in den Darstellungen Indikatoren dafür, dass der Darstellung kein wirkliches Interesse an den Anderen, sondern ein Interesse an der eigenen Identität und der Legitimation der eigenen Machtposition zugrunde liegt. Dies heißt nicht im Umkehrschluss, dass eine sachlich richtige Darstellung über jeden Rassismusverdacht erhaben wäre, es heißt aber, dass bestimmmte sachliche Fehler Rassismus indizieren können.
Eng verbunden mit dem Kriterium propositionaler Wahrheit ist das fünfte und letzte inhaltliche Kriterium. Insbesondere gegen Kristeva bringt Spivak wiederholt vor, dass deren Darstellungen nicht in einer nachvollziehbaren Weise auf überprüfbaren Methoden beruhten. Die dabei formulierten methodologischen Forderungen sind durchweg die, die in den jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen vorgesehen wären. Also geht es Spivak letztlich auch ganz banal um wissenschaftlich-methodologische Sorgfalt – besteht hieran ein Mangel, hält sie eine selbstzentrierte Motivation und einen herrschaftsstabilisierenden Effekt für wahrscheinlich.
Fazit: Folgerungen für Theorie und Praxis
Aus diesen Kriterien, die Spivak zwar nicht explizit formuliert und systematisiert, die sie aber performativ relativ konsistent verfolgt, sind sowohl für die theoretische Arbeit als auch für die kritische Praxis Konsequenzen zu ziehen.
In der theoretischen Arbeit scheint es erstrebenswert, die implizite Methodologie auch explizit zu entfalten und durchzuargumentieren. Das heißt, dass die von Spivak faktisch angelegten Rationalitätskriterien – und es handelt sich eindeutig um Rationalitätskriterien – systematisiert und begründet werden müssten. Ich schlage sowohl in Kapitel 9 meiner Dissertation als auch in anderen Aufsätzen vor, dies durch Jürgen Habermas‘ Begriff kommunikativer Rationalität sowie durch sein Konzept der systematisch verzerrten Kommunikation zu erreichen. Dann wird die zu erstrebende Rationalität ebenso wie ihre rassistische Verzerrung nicht in den einzelnen Subjekten, sondern in den Kommunikationsverhältnissen verortet. Einzelne Sprechakte sind dann danach zu beurteilen, ob sie die Verzerrung verstärken oder destabilisieren.
In der kritischen Praxis innerhalb der gegenwärtigen Islamdebatten dagegen sollte die Konsequenz vor allem darin bestehen, es sich bei der Rassismuskritik nicht zu leicht zu machen. Wer Darstellungen von patriarchalischer Normen und Praktiken in islamischen Kontexten mit Spivak als paternalistischen Rettungsdiskurs bezeichnet, sollte auch bereit sein, die Beweislast zu tragen, die Spivak mit diesem Vorwurf verbindet. Die zentrale Lektion von Spivaks Subaltern Aufsatz besteht darin, dass sowohl eine allzu vorschnelle Rassismuskritik ebenso wie eine allzu vorschnelle „Islamkritik“ Gefahr läuft, Herrschaft zu stabilisieren anstatt zu kritisieren.
Anmerkungen:
[1] Ich verwende in diesem Vortrag das generische Femininum. Sofern der Kontext es nicht anders impliziert, beziehen sich weibliche Formen auf die entsprechenden Personen unabhängig von ihrer Identifizierung. Männer sind mitgemeint.