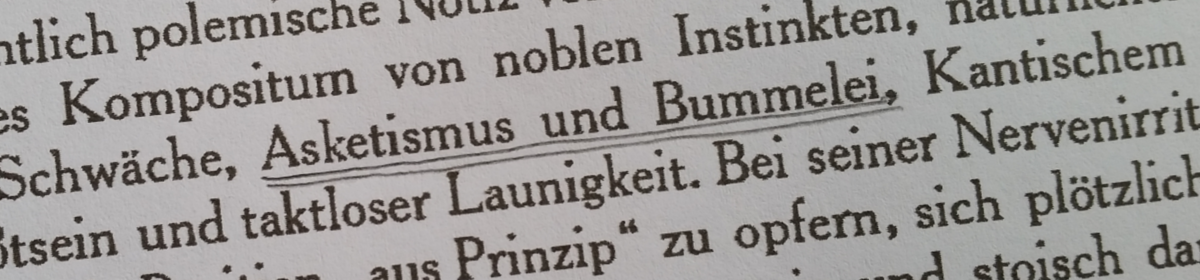Wenn Judith Butler und Sabine Hark auf der einen, Alice Schwarzer auf der anderen Seite sich wechselseitig Rassismus vorwerfen, ist das in jedem Falle ein Ereignis. Es könnte auch der Ausgangspunkt für eine produktive Debatte über Rassismus und Feminismus sein, stellt sich bislang aber eher als kontroverses Teekesselchen-Spiel dar.
Floris Biskamp
Vieles an der Diskussion zwischen Judith Butler, Sabine Hark und Alice Schwarzer (und Vojin Saša Vukadinović und Patsy l’Amour laLove und und und) ist frustrierend. Der Umgang mit Rassismusvorwürfen ist es in besonderem Maße, weil er einmal mehr zeigt, wie unmöglich es ist, in der Öffentlichkeit eine produktive Debatte über Rassismus zu führen.

Nehmen wir nur die jüngste Runde der Auseinandersetzung in der Zeit sowie ihre mediale Bewertung. Indem Judith Butler und Sabine Hark ihre Replik auf den Emma-Schwerpunkt in der Zeit veröffentlichten, erhöhten sie nochmals den Einsatz in einer Diskussion, die mit dem Buch Beißreflexe an den linken, queeren und feministischen Rändern der Öffentlichkeit angefangen hat und seitdem nach und nach in den feuilletonistischen Mainstream vorgedrungen ist.
Besondere Aufmerksamkeit in der Rezeption dieser jüngsten Runde erfuhr die Aushandlung von Rassismusvorwürfen. Butler und Hark warfen Emma (und damit implizit der an dieser Stelle nicht namentlich genannten Schwarzer) vor, für einen Feminismus zu stehen, „der kein Problem mit Rassismus hat“. Das ließ Schwarzer nicht auf sich und ihrer Zeitschrift sitzen. In ihrer Replik weist sie diesen Rassismusvorwurf als eine Verleumdung zurück, auf die nur hereinfallen könne, wer die wirklichen Positionen von Emma nicht kenne. Mehr als das: Sie schickt den Vorwurf auch postwendend zurück an die Absenderinnen und betont, die vermeintliche Rassismuskritik von Butler und Hark sei selbst rassistisch.
Dieser Debattenverlauf ist leider paradigmatisch für gegenwärtige Diskussionen über Rassismus. Fast ist es wie ein Teekesselchen-Spiel: Beide Seiten benutzen dasselbe Wort „Rassismus“, meinen damit aber offenbar grundsätzlich Verschiedenes. Doch anders als in einem Teekesselchen-Spiel geht es dabei sehr kontrovers zu.
Ein gehöriges Maß an Verständigungsorientierung, Zeit und Raum vorausgesetzt, ließe sich ein solcher Konflikt wohl mit Argumenten auflösen oder zumindest reflektieren. Dafür müsste einerseits ausgehandelt werden, was sinnvollerweise unter Rassismus zu verstehen ist bzw. nach welchen Kriterien bestimmte Positionen oder Äußerungen als rassistisch auszuweisen sind. Andererseits wäre zu diskutieren, inwiefern die Praxis von Emma und die ihrer Kritiker_innen diesen Kriterien zufolge als rassistisch zu bezeichnen ist.
In Diskussionen über Rassismus ist eine solche Verständigung aber kaum je zu beobachten. Steht der Rassismusvorwurf einmal im Raum, beginnt in der Regel keine kommunikative Aushandlung, sondern ein Austausch von Vorwürfen, bei dem sich Dritte dann auf die eine oder andere Seite stellen. Warum das passiert, ist durchaus nachzuvollziehen: Zum einen ist ein Rassismusvorwurf in aller Regel nichts, was bei den Adressat_innen Lust auf den Austausch von Gründen weckt; zum anderen ist – auch im Zeit-Feuilleton – kaum Platz für derartige Erörterungen.
Im Folgenden versuche ich anhand der Formulierungen von Butler/Hark und Schwarzer zumindest zu skizzieren, welche Begriffe von Rassismus aufeinanderprallen, um die ausbleibende Aushandlungen andeutungsweise zu simulieren – und darzulegen, dass sie in der Rezeption teils auf Grundlage falscher Prämissen diskutiert wird.
Butler und Hark: Rassismus und Diskurs
Wie problematisieren Butler und Hark Rassismus?
Zum Beispiel haben die unmissverständlich zu verurteilenden Angriffe auf Frauen in der Kölner Silvesternacht einen Anlass für die Mobilisierung von Gender, Sexualität und einer bestimmten Vorstellung von Frauenemanzipation geboten, die zur Rechtfertigung rassistischer beziehungsweise islamfeindlicher Ausgrenzungspolitiken dienten. So stehen wir wieder einmal vor der Aufgabe, uns zu fragen, wie Rassismus und Gewalt gegen Frauen innerhalb desselben Rahmens adressiert werden können. Wie wir also einen nicht-rassistischen, anti-sexistischen Diskurs führen können, der zugleich ein nicht-sexistischer, anti-rassistischer Diskurs ist. Die Zeitschrift Emma scheint hier eher vorzuschlagen, wir sollten uns in der Verurteilung nicht-westlicher, muslimischer Migranten engagieren, da die Sorge um die Zunahme von Rassismus vom eigentlichen Geschehen – sexualisierter Gewalt gegen Frauen – ablenke.
Welchen Feminismus auch immer Emma vor Augen hat, es scheint ein Feminismus zu sein, der kein Problem mit Rassismus hat und der nicht bereit ist, rassistische Formen und Praktiken der Macht zu verurteilen.
Auffällig ist zunächst, dass die beiden Autorinnen – anders als in der Rezeption insinuiert – gar nicht explizit schreiben, dass Schwarzer oder Emma selbst rassistisch seien oder Rassistisches getan hätten. Vielmehr verweisen Sie darauf, dass es in der öffentlichen Debatte insbesondere ’nach Köln‘ eine „Mobilisierung von Gender, Sexualität und einer bestimmten Vorstellung von Frauenemanzipation“ gebe, die der „Rechtfertigunug rassistischer beziehungsweise islamfeindlicher Ausgrenzungspolitiken dienten.“ Der Vorwurf an Emma lautet, dass man dort ein Engagement „in der Verurteiung nicht-westlicher, muslimischer Migranten“ befürworte, ohne zu reflektieren, dass man der rassistischen Mobilisierung damit in die Hände spiele. Daher sei der Feminismus von Emma einer, der Rassismus nicht problematisiere, sondern – so der implizite Vorwurf – noch verstärke.
Die beiden gehen also davon aus, dass es eine Diskriminierung gegenüber Muslimen gibt, die als rassistisch zu bezeichnen ist, und dass jedes (auch jedes feministische) Sprechen über den Islam Gefahr läuft, zur Rechtfertigung dieser Diskriminierung beizutragen. Was sie an der Praxis der Emma kritisieren, ist insbesondere eine mangelnde Sensibilität für diesen diskursiven Kontext und die in diesem Kontext zu erwartenden rassistischen Effekte der eigenen feministischen Praxis.
Schwarzer: Rassismus als Homogenisierung
Wie reagiert Schwarzer nun auf diesen Vorwurf? Sie weicht ihm aus, indem sie einen anderen Rassismusbegriff verwendet.
Die implizierte Forderung nach einer Reflexion des diskursiven Kontexts und des potenziellen diskriminierenden Effekts der eigenen Praxis taucht bei ihr gar nicht erst auf. Weder versucht sie darzulegen, dass sie solche Reflexionen sehr wohl vollziehe, noch weist sie die Forderung selbst als falsch zurück. Stattdessen ignoriert sie das von Butler und Hark vorgebrachte Argument und stellt den Rassismusvorwurf zunächst als bloße Diffamierung dar:
Die Chefdenkerin der Queer-Theorie, Judith Butler, unterstellt Emma nicht nur undifferenziertes Denken und „Hassreden“, sondern sogar Rassismus. Ein Argument, das uns definitiv ins Unrecht setzen soll.
Und:
Denn Kritikerinnen, denen man unterstellt, sie seien Rassistinnen niederer Machart, die den eigenen hohen Gedanken kaum folgen können, solche Kritikerinnen brauchen den Mund gar nicht mehr erst aufzumachen. Sie sind schon von vorneherein erledigt.
Hier lässt sich bereits die erste Differenz in der Verwendung des Rassismusbegriffs erkennen. Während Butler und Hark auf die Reflexion der möglichen Konsequenzen feministischer Praxis zielen, wehrt sich Schwarzer gegen ein von den beiden gar nicht vorgebrachtes Argument ad personam. Nirgends schreiben die beiden auch nur annäherungsweise, irgendeine Person sei höherer oder gar „niederer Machart“ (Schwarzer führt diesen Punkt wohl in der Hoffnung ein, antiintellektuelle Affekte zu mobilisieren; nicht ohne Erfolg, wie die Rezeption zeigt). Dies ist typisch für den Verlauf von Aushandlungen um Rassismus: Rassismusvorwürfe werden – relativ unabhängig davon, wie sie formuliert sind – regelmäßig als persönlicher Vorwurf verstanden und zurückgewiesen: „Was Du gesagt hast scheint mir rassistisch.“ „Ich bin keine Rassistin.“
Jedoch belässt es Schwarzer nicht dabei:
Der Ton von Butler und Hark verschärft sich beim Thema Islam. Die Politisierung des Islams mit all ihren Folgen – von der rigiden Geschlechtertrennung bis hin zum blutigen Terror – wird seit Jahrzehnten von aufgeklärten Muslimen ebenso bekämpft wie von universell denkenden Westlern, aber das ignorieren diese selbst ernannten „Anti-Rassistinnen“ geflissentlich. Bei ihrer Kritik an der „Kritik am Islam“ (was bedacht heißen müsste: Islamismus) fällt ihnen nur drohende „Verwestlichung“ und „Freiwilligkeit“ der Kopftuch- und Burka-Trägerinnen ein. Haben die erklärten Anti-Rassistinnen da eigentlich keine Angst vor dem sonst so gerne beschworenen „Beifall von der falschen Seite“, nämlich der Islamisten?
Dies ist der Punkt, an dem Schwarzer dem Argument von Butler und Hark am nächsten kommt. Zwar geht es diesen nicht um „Beifall von der falschen Seite“, sondern um die Gefahr, mit der eigenen feministischen Praxis rassistische Diskurse zu verstärken, aber: This is as close as it gets.
Und auch wenn im Text von Butler und Hark die Worte Verwestlichung und Freiwilligkeit ebenso wenig vorkommen wie Kopftuch und Burka, bringt Schwarzer an dieser Stelle ihr stärkstes Argument vor. Sie verweist auf ein reales Problem von rassismuskritischen Positionen, wie Butler und Hark sie beziehen: Wenn wir in unserem Sprechen über Sexismus, Heternormativität, Homophobie, Antisemitismus usw. darauf bedacht sind, keine antimuslimisch-rassistischen Diskurse zu bestärken, laufen wir damit nicht Gefahr, uns von denjenigen zu entsolidarisieren, die von spezifisch muslimischen oder islamischen Ausprägungen von Sexismus, Heternormativität, Homophobie, Antisemitismus usw. betroffen sind? Wenn es diese Probleme in einer solchen spezifischen Ausprägung gibt, wie ist zu verfahren? Ist es sinnvoll, diese spezifische Dimension zu ignorieren und nur von Sexismus, Heternormativität, Homophobie, Antisemitismus usw. in abstracto zu sprechen? Macht man damit spezifische Probleme und spezifisches Leiden unsichtbar? Begeht man einen Verrat an den Betroffenen? Und wie wäre dies zu vermeiden?
Dies wäre eine Reflexion, die an dieser Stelle anstünde. Tatsächlich hat Schwarzer auch eine Lösung für das Problem, doch leider fällt diese allzu grob aus.
Hier wird also wieder einmal der Rassismus gegen den Sexismus ausgespielt. Richtig: Für uns als feministische Zeitschrift hat der Kampf gegen den Sexismus Priorität –, aber ist gleichzeitig der Kampf gegen den Rassismus für Feministinnen immer schon eine Selbstverständlichkeit gewesen. So haben die amerikanischen Suffragetten im 19. Jahrhundert sich zunächst für gleiche Rechte für die Schwarzen eingesetzt – bis sie erkannten, dass auch für sie, die Frauen, noch ein gewisser Handlungsbedarf besteht.
Antirassismus wird als sehr einfache Angelegenheit dargestellt, die für Feministinnen eine schlichte Selbstverständlichkeit sei. Demnach kann man ganz einfach gegen Sexismus und gegen Rassismus sein, ohne dass beides in Spannung gerät. Die Spannung zwischen Antisexismus und Antirassismus, die im Kern von Butlers und Harks Argument steht, wird als bloße Fiktion abgetan.
Damit ist auch deutlich, dass Schwarzer unter Rassismus etwas anderes verstehen muss als Butler und Hark. Verstünde auch sie Rassismus als eine diskriminierende Struktur, die durch Diskurse legitimiert wird, für die auch feministische Argumente mobilisiert werden, könnte ihre Positionierung kaum so eindeutig sein. Was aber ist Rassismus für Schwarzer? Sie definiert ihn nicht direkt, ihre Zurückweisung des Rassismusvorwurfs liefert aber eine (Teil-)Definition ex negativo:
Diese Frauen können allerdings noch nie eine Emma gelesen haben (wie so viele von Emmas Kritikern) – oder sie sind schlicht borniert oder bösartig. Oder aber sie schreiben einfach bei den (meist linken) Verleumdern im Netz ab, die Emma seit Jahren des „Rassismus“ bezichtigen.
Warum? Weil Emma seit 1979, seit der Machtübernahme von Khomeini im Iran, vor der Offensive des politisierten Islams warnt. Denn die ersten Opfer der Islamisten waren und sind Musliminnen: erst die Frauen, dann die Intellektuellen und Künstler, die Homosexuellen und sodann alle, die noch nicht auf den Knien liegen. Die Juden nicht zu vergessen.
Ich bin seit Jahrzehnten in Deutschland eine der wenigen Stimmen – lange die einzige –, die strikt unterscheidet zwischen Islam (dem Glauben) und Islamismus (der Ideologie). Doch das schert meine Verleumderinnen nicht. Dreist behaupten sie gebetsmühlenartig, ich sei eine „Islamkritikerin“ (Dabei habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie zum Islam geäußert). Sie unterscheiden so wenig zwischen Islam und Islamismus, wie Pegida oder die AfD es tun.
Und weiter:
Es handelte sich bei der Gewalt aus den Reihen der etwa 2000 jungen muslimischen Flüchtlinge und Illegalen auf dem Kölner Bahnhofsplatz nicht um individuelle Ausrutscher, sondern um eine politische Demonstration: Uns Frauen sollte gezeigt werden, dass wir am Abend nichts zu suchen haben im öffentlichen Raum – oder aber Flittchen und Freiwild sind. Von Kairo bis Köln. Die Silvesternacht ist nicht zufällig weltweit zum Symbol geworden; sie war eine neue Variante dessen, was der französische Islamexperte Gilles Kepel den „Dschihadismus von unten“ nennt.
Das nicht erkennen zu wollen ist in der Tat rassistisch. Denn es nimmt alle Muslime in Zwangsgemeinschaft mit diesen frustrierten, entwurzelten, fanatisierten Männern. Es ignoriert, dass der Geist, in dem die Männer in Köln gehandelt haben – dieses fatale Gebräu aus patriarchaler Tradition und fundamentalistischem Islam – keineswegs gleichzusetzen ist mit „dem“ Islam.
Schwarzer nennt hier zwei Gründe dafür, warum die kritische Praxis der Emma gar nicht rassistisch sein könne: Erstens sei man – aus Solidarität mit Musliminnen! – schon seit 1979 gegen Islamismus. Zweitens sei man eben nur gegen Islamismus, den man vom Islam sauber differenziere. (Die Behauptung, dass Schwarzer lange die einzige Stimme in Deutschland gewesen sei, die zwischen Islam und Islamismus differenziert habe, sei an dieser Stelle nicht weiter kommentiert.)
Wer zwischen Islam und Islamismus unterscheidet, kann demnach gar nicht rassistisch sein. Implizit wird damit die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus zum alles entscheidenden Lackmustest der Rassismuskritik. Und das ist auch die Grundlage der Pointe von Schwarzers Gegenkritik: Weil ihre Kritikerinnen nicht zwischen Islamkritik und Islamismuskritik unterschieden, unterschieden sie implizit auch nicht zwischen Islam und Islamismus und seien somit letztlich selbst rassistisch.
Nun ist es zweifellos wichtig, zwischen jenen Muslim_innen, die den Islam beispielsweise als eine bestimmte spirituelle Haltung oder als Anleitung für ihr eigenes gottgefälliges Leben betrachten, auf der einen Seite und jenen Muslim_innen, die Religion islamistisch als allgemeinverbindlich durchzusetzende Vorgabe für die Einrichtung von Staat und Gesellschaft betrachten, auf der anderen Seite zu unterscheiden (auch Butler und Hark hätten gegen diese Unterscheidung wohl allenfalls einzuwenden, dass sie zu einfach ist und selbst wieder problematische Funktionen erfüllen kann). Warum aber das Vollziehen oder Unterlassen dieser Unterscheidung das alles entscheidende Kriterium für Rassismuskritik sein soll, erläutert Schwarzer mit keinem Wort. Vielmehr setzt sie es schlicht voraus.
Bei genauerer Betrachtung scheint dieses Kriterium zugleich zu weit und zu eng. Einerseits sehe ich nicht ein, warum eine Kritik, die Islam und Islamismus unterscheidet, nicht mehr rassistisch sein könnte. Andererseits erschließt es sich mir nicht, warum es per se rassistisch sein sollte, islamische Normen und Praktiken jenseits des Islamismus zu kritisieren. Es gab im Islam schon strikt patriarchalische Geschlechternormen, bevor es Islamismus gab; und es gibt diese Normen und Praktiken auch weiterhin in nicht islamistischen Kontexten. Warum sollte es per se rassistisch sein, dies zu kritisieren? Wann und unter welchen Bedingungen wäre es rassistisch? Schwarzer umgeht dieses Problem regelmäßig, indem sie alles Islamische, das ihr als problematisch erscheint schlicht dem Islamismus subsumiert – sei es, indem sie das Kopftuch auf eine „Flagge der Islamisten“ reduziert, sei es, indem sie wie im vorliegenden Artikel die Täter der Kölner Silvesternach kurzerhand zu Islamisten erklärt. Beides sind jedoch relativ willkürliche Setzungen.
So liefert Schwarzers implizite Rassismusdefinition zwar einen sehr einfachen Leitfaden für die nichtrassistische feministischePraxis. Überzeugen kann sie aber nicht.
Was zu diskutieren wäre und was diskutiert wird
Eine produktive Debatte müsste nun einerseits fragen, unter welchen Bedingungen es Sinn macht, ein bestimmtes Sprechen über den Islam als rassistisch zu bezeichnen. Es wäre sowohl das von Butler und Hark aufgeworfene Problem zu diskutieren, dass eine bestimmte Mobilisierung feministischer Argumente rassistische Exklusionen verstärkern könnte, als auch das von Schwarzer aufgeworfene Problem, dass Rassismuskritik Gefahr läuft, Probleme innerhalb des Islam der Thematisierung zu entziehen und sich so von den Betroffenen zu entsolidarisiern.
Blickt man auf die Rezeption des Streits, findet eine solche Debatte aber kaum statt. Paradigmatisch sind die Beiträge von Jan Feddersen in der taz und von Franziska Walser bei Deutschlandfunk Kultur.
Feddersen sieht den Kern des Streits ebenfalls bei der Diskussion um Rassismus und Islam:
[Hier] steckt die wahre Kontroverse – es geht natürlich auch, wie es in den „Beißreflexen“ heißt, um Sprechverbote, die auch Hark und Butler betreffen, um inquisitorisch anmutende Moralen im Sinne von „Das darf man nicht sagen, weil es sonst den Rechten nützt“, es geht um den Rang von Menschenrechten.
Schwarzer, nun wahrlich keine Linke, beharrt darauf, dass es zunächst und vor allem um den Schutz von Schwächeren, das heißt historisch gesehen immer von Frauen, Minderheiten wie Schwulen und Lesben und Trans* geht, nicht um kulturalisierende Verniedlichungen von politischen Regimen wie dem Iran, wo Frauen Kopftücher tragen müssen, wollen sie nicht drakonische Strafen riskieren oder gar den Tod. […]
Der Streit, ausgehend von den „Beißreflexen“ Patsy L’Amour LaLoves und der Emma, ausgetragen in der Zeit, repräsentiert die Trennlinie des feministischen Diskurses: hier die Menschenrechtsorientierten, die – etwa in den muslimischen Communities – für alle eintreten, die sich von den religiösen Zwangsregimen lösen wollen, wie Seyran Ates etwa; dort die Kulturalisten und Queeristen, die zum Teil in der Kritik an Muslimen Islamophobie erkennen wollen – und davor warnen, dass jeder Einwand gegen islam(ist)ische Praxen als den Rechten dienlich abtun oder von sich weisen.
Auf der einen Seite aufrechte Verfechter_innen der Menschenrechte, die sich bedingungslos auf die Seite der Schwachen stellen, auf der anderen Seite „Kulturalisten und Queeristen“, die in bloßer Kritik am Islamismus schon Islamophobie erkennen und jeden Einwand einfach abtun und von sich weisen. Wer wird, vor diese Alternative gestellt, schon lange überlegen müssen? Dass es auch Butler und Hark ganz eindeutig um das Wohl von Schwächeren geht, sie aber davor warnen, dass auch wohlmeindende politische Praktiken, die sich für Schwächere einsetzen wollen, zugleich andere Schwächere weiter marginalisieren, das kann ein_e Leser_in von Feddersens Text nicht einmal erahnen.
Seltsam auch, dass Feddersens Formulierungen eine Kritik an islamischen Problemen jenseits des Islamismus implizieren. Solche Kritik kann er ja mit Gründen üben, dass er sich dabei aber auf diesen Text von Schwarzer beruft, überrascht.
Walsers Beitrag ist nicht in diesem Sinne offen parteiisch. Vielmehr stellt sie den Streit als einen Boxkampf zwischen einer politischen Pragmatikerin und einer akademischen Theoretikerin dar, über den sie als neutrale Kommentatorin berichtet. Nachdem beide Kämpferinnen beim offiziellen Wiegen als provokant und streitlustig eingeführt sind und die Ringglocke die erste Runde eingeläutet hat, sagt sie:
Es geht um die Frage, ob man aus feministischer Perspektive den Islam kritisieren kann. Ja, sagt Alice Schwarzer ganz pragmatisch, weil Frauenrecht Menschenrecht ist, und das gilt universell. Judith Butler, Philosophin des Poststrukturalismus, würde das eher theoretisch beantworten: Die Andersheit des Anderen kann eigentlich kein Außenstehender beurteilen.
Wie ist eine solche Zusammenfassung möglich? Wer hat in dem Streit die Frage aufgeworfen, „ob man den Islam kritisieren kann“? Das Können wird von Butler und Hark nicht in Zweifel gezogen – vielmehr verweisen sie auf bestimmte Effekte, die Kritik unter den gegebenen diskursiven Umständen hat. Ob ein Außenstehender die Andersheit des Anderen nicht beurteilen kann, wurde (zumindest in der Zeit-Debatte) gar nicht erst explizit diskutiert (Butlers von Schwarzer falsch zitierte Äußerungen über Verschleierung verweisen aber darauf, dass Butler durchaus davon ausgeht, dass auch eine Nichtmuslima Urteile über muslimische Praktiken fällen kann). Noch absurder ist Walsers Zusammenfassung von Schwarzer Position. Diese wiederholt, dass sie nie im Leben den Islam, sondern seit 38 Jahren immer nur den Islamismus kritisiert habe, und impliziert recht deutlich, eine Kritik am Islam sei selbst rassistisch – und nun wird sie (allem Anschein nach wohlwollend) so gelesen, als sage sie „ganz pragmatisch“, man könne den Islam kritisieren?
Auch wenn Feddersen und Walser unterschiedliche Urteile fällen, haben ihre Interpretationen eines gemeinsam: Sie vereindeutigen das in der Zeit vollzogene Teekesselchen-Spiel um den Rassismusvorwurf zu einfachen Alternativen, die bei Butler, Hark und Zeit gar nicht auftauchen.
(Ich vermute, dass man auch eine dritte Position finden könnte, die sich ebenso plump hinter Butler und Hark stellt, wie Feddersen hinter Schwarzer, aber begegnet ist mir bislang keine.)
Ratlosigkeit zum Schluss
Angesichts dieser Nicht-Kommunikation ist man ratlos: Es gibt ein Spannungsfeld von Islam, Feminismus und Rassismus. Jede politische Praxis, die sich auf dieses Feld begibt, täte gut daran, die Spannung zu reflektieren. Wenn aber nun eine Debatte über diese Spannungen in der rennomiertesten deutschen Wochenzeitung einem Teekesselchen-Spiel gleicht, wenn auch Medien wie taz und Deutschlandfunk Kultur die Positionen in dieser Debatte grob missrepräsentieren, wo und wie soll die Reflexion dann sinnvollerweise stattfinden?