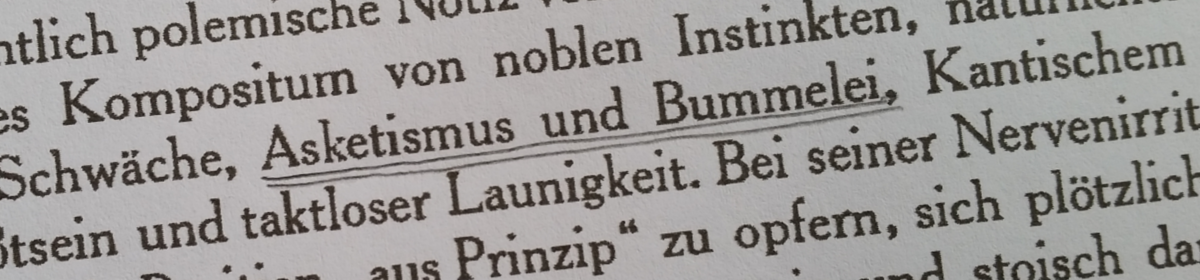Ich habe keine Strichliste geführt, aber meiner gefühlten, durch meine Panelauswahl hoch selektiven Empirie zufolge ist Jan-Werner Müller der bislang (Stand: Mittwoch 11:19 Uhr) meistzitierte Theoretiker beim diesjährigen DVPW-Kongress Die Grenzen der Demokratie: Er wurde im gestrigen Panel Democratic Anxieties zitiert, er wurde in der Podiumsdiskussion während der Eröffnungsveranstaltung zitiert und er wurde in der heutigen Rede des Bundespräsidenten zitiert. Zitiert werden (nicht nur diese Woche in Frankfurt)) insbesondere zwei miteinander verknüpfte Thesen, aus denen immer wieder falsche Schlüsse gezogen werden. Ich rekonstruiere diese Thesen und die mit ihnen verbundenen Probleme hier nicht aus Müllers Buch Was ist Populismus?, sondern stelle sie bezogen auf die Art und Weise dar, auf die sie zitiert und benutzt werden.
Die erste These und die falschen Schlüsse, die aus ihr gezogen werden: Populismus sei notwendig antipluralistisch und antidemokratisch
Die erste These ergibt sich aus der Definition von Populismus, die Müller vertritt. Populismus besteht demzufolge nicht nur in einer Gegenüberstellung von korrupten Eliten einerseits und einem guten Volk, dessen Souveränität hergestellt werden soll, andererseits; Müllers Thesen zufolge behaupten Populist_innen auch, dass es einen homogenen Volkswillen gebe, den ausschließlich sie selbst verträten. Daher – und dies ist die erste These – sei Populismus notwendigerweise antipluralistisch und antidemokratisch.
Jedoch stellt sich dann die Frage, was man mit einer Mobilisierung wie der von Bernie Sanders im Präsidentschafts(vor)wahlkampf 2016 macht. Diese wurde in der Öffentlichkeit als populistisch wahrgenommen und erfüllt auch die Kriterien gängiger Populismusdefinitionen, wie der von Cas Mudde. In der Sanders-Kampagne wurde eine Kritik formuliert, der zufolge bestimmte politische, ökonomische und technokratische Eliten in einer Weise agierten, die den Interessen der übergroßen Mehrheit zuwiderlaufen, wogegen das Volk demokratisch mobilisiert werden sollte. Jedoch war diese Mobilisierung auch ganz dezidiert pluralistisch.
Freilich könnte man Müllers Definition und These aufrechterhalten und darlegen, dass Sanders 2016 nicht antipluralistisch und deshalb eben definitionsgemäß nicht populistisch war. Eine solche Konzeptionierung ist in sich kohärent, hat jedoch zwei entscheidende Nachteile.
Erstens verliert man dadurch die Ähnlichkeiten, die zwischen den verschiedenen im weiteren Sinne populistischen Formen der Mobilisierung bestehen, aus dem Blick. Bei allen Unterschieden, die man deskriptiv und normativ zwischen Sanders 2016 und Trump 2016 mit guten Gründen herausarbeiten kann und sollte, ist es auch wichtig, die Ähnlichkeiten sowohl in der Form der Mobilisierung als auch in den Ursachen begrifflich zu fassen (diese Ählichkeiten benannte gestern Frances Lee). Hierfür ist ein hinreichend weiter Populismusbegriff hilfreich. Dann kann man immer noch verschiedene Formen von Populismus unterscheiden – pluralistische und antipluralistische, linke und rechte etc.
Zweitens stellt sich mit Müllers Definition die Gefahr eines unfairen Fehlschlusses ein, der sich auch empirisch immer wieder beobachten lässt. Wenn jemand das Volk gegen Eliten mobilisiert, wird diese Mobilisierung als populistisch bezeichnet, um im nächsten Schritt mit Verweis auf Müller darzulegen, dass solcher Populismus immer auch antipluralistisch und antidemokratisch sei. Damit wird eine demokratische Mobilisierung wie die von Sanders im Handstreich delegitimiert und die dabei formulierte Kritik abgetan – so könnte man auch Frank-Walter Steinmeiers heutige Zurückweiseung des Populismus als eine Gefahr für die Demokratie verstehen. (Fairerweise ist zu erwähnen, dass Steinmeier Technokratie als zweite Gefahr nannte.)
Das Risiko dieses Fehlschlusses (auf das Wolfgang Merkel gestern auch hinwies) verkleinert man, wenn man Populismus offener definiert und Antipluralismus als eine mögliche Haltung bestimmter Populismen kritisiert, die dann aber auch jeweils nachzuweisen ist, anstatt vorab gegen jede populistische Mobilisierung zu polemisieren (auf die Unterschiede verschiedener Populismen in Hinblick auf Antipluralismus verwies gestern Marcel Lewandowsky).
Die zweite These und ihre falschen Schlüsse, die aus ihr gezogen werden: Demokratie müsse liberal sein
Die zweite These, mit der Müller stets zitiert wird, bezieht sich nicht auf populistische Mobilisierung, sondern auf die Folgen von Populismus für das politische System, die sich insbesondere in Ungarn, Polen und der Türkei beobachten lassen. In diesen Ländern wird zwar weiterhin gewählt, rechtsstaatliche und liberale Institutionen sind aber ausgehöhlt – eine Konstellation, für die sich der Begriff der häufig mit Fingerspitzen angefasste Begriff „illiberalen Demokratie“ zu etablieren scheint.
Auch Müller problematisiert diesen Begriff und betont, dass solche illiberalen Regimes gerade keine Demokratien mehr seien. Die Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit und Öffentlichkeit unterminiere auch den demokratischen Prozess, sodass Wahlen keine demokratische Legitimität mehr verliehen und von Demokratie nicht mehr die Rede sein könne.
Diese These halte ich für richtig. Wenn aus einer liberalen Demokratie der Liberalismus verschwindet, ist es keine illiberale Demokratie, sondern gar keine (dieselbe These habe ich mit positivem Bezug auf Müller auch selbst schon vertreten).
Falsch wird es, wenn aus dieser Aussage über einen bestimmten Verfallsprozess liberaldemokratischer Regimes allgemeine demokratietheoretische Konsequenzen gezogen werden. Diesen Fehlschluss hat heute der Bundespräsident idealtypisch formuliert, als er mit Referenz auf Jan-Werner Müller sagte: „Demokratie ist entweder liberal oder sie ist nicht.“
Mit dieser Behauptung werden aus einer richtigen Beobachtung falsche Konsequenzen gezogen. Liberale Demokratie ist nicht die einzig mögliche Form von Demokratie und Victor Órbans Regime in Ungarn ist nicht geeignet, um das Gegenteil zu belegen.
Liberale Demokratie ist entweder liberal oder sie ist keine Demokratie, aber damit ist das letzte Wort über das, was Demokratie sein kann, nicht gesprochen.