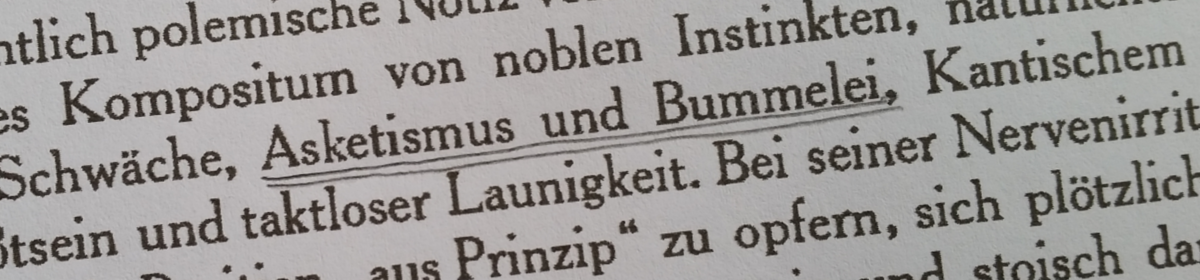Gestern wurden mir in einem Radiointerview Fragen über Israelkritik und Antisemitismus gestellt, die ich in der Vergangenheit schon oft und mit Leichtigkeit beantwortet hatte. Gestern musste ich um Worte ringen.
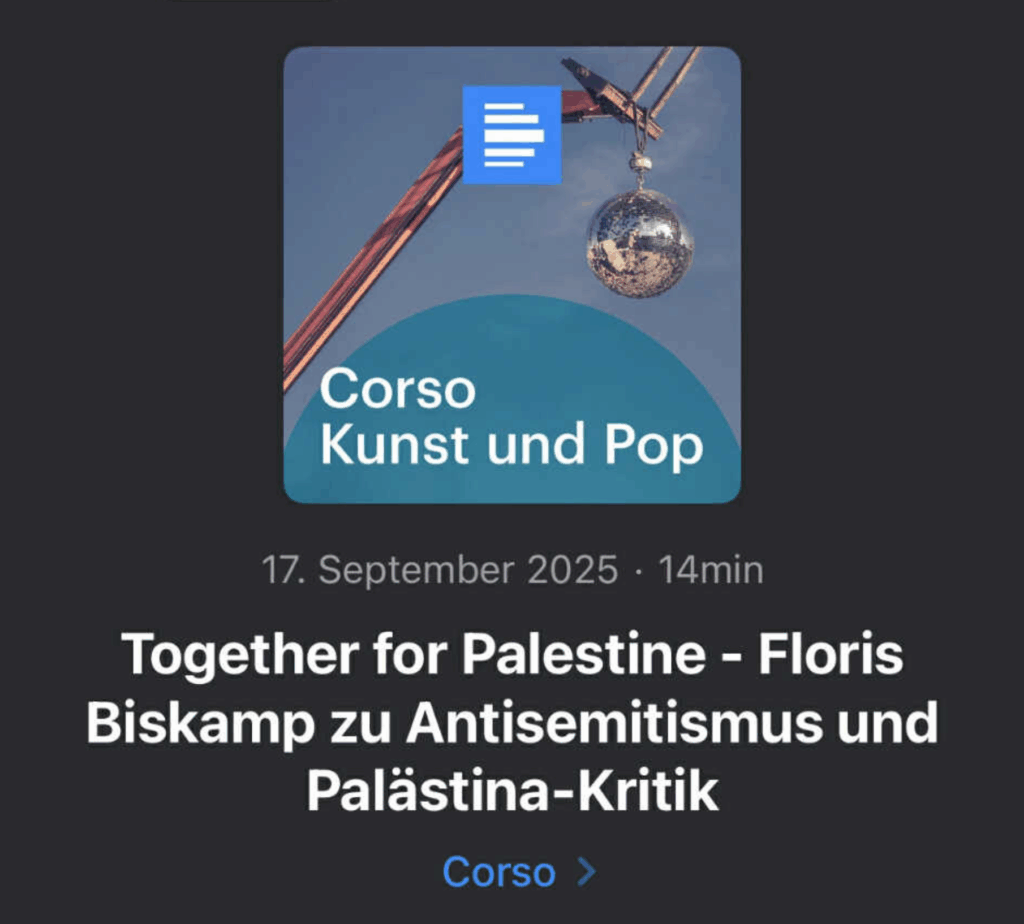
Gestern war ich mal wieder im Radio. Thema waren Sagbarkeitsgrenzen in der Nahostdebatte. Selten fiel mir das Antworten in einem Interview so schwer und ich denke gerade darüber nach, warum das so war.
Bei Radiointerviews sind die Fragen manchmal im Vorhinein sehr konkret abgesprochen, manchmal nur das ungefähre Thema. Ersteres führt oft zu den durchdachteren Antworten (logisch), letzteres ermöglicht ein spontaneres Gespräch, was dann für alle natürlicher wirken und interessanter sein kann.
Gestern war letzteres der Fall. Nach der Anfrage dachte ich, dass ich nach analytischen Urteilen darüber gefragt werde, wie sich die Sagbarkeitsgrenzen in Debatten um Israel in den letzten Jahren verändert haben und wo sie verlaufen. Allerdings wurde ich dann relativ direkt nach normativen Urteilen darüber gefragt, wo Antisemitismus anfängt, implizit also: wo Sagbarkeitsgrenzen verlaufen sollten.
Solche Fragen wurden mir in der Vergangenheit schon x Mal gestellt. „Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Palästinasolidarität/Israelkritik und Antisemitismus?“ „Wenn Künstler:in X y tut, ist das dann antisemitisch?“ Etc. Vor ein paar Jahren hätte ich sie im Schlaf beantworten können (3-D-Test, IHRA, JDA, whatever), aber gestern musste ich sehr um die Worte ringen.
Das liegt (glaube ich zumindest) nur in geringem Maße daran, dass meine grundlegende Position sich geändert hätte, und vielmehr daran, dass die Situation sich geändert hat. Es liegt an dem, was in Gaza und auch in der Westbank in den letzten anderthalb Jahren geschehen ist und sich nun weiter zuspitzt.
Die Frage nach israelbezogenem Antisemitismus bleibt relevant und aktuell. Das zeigt zum Beispiel der Fall Lahav Shani. Mit Shani wurde jemand gecancelt, dem man (anders als seinem Vorgänger Gergijew) individuell wenig vorwerfen kann, was nahelegt, dass es sich um antisemitische Diskriminierung handelt.
Allerdings halte ich es für falsch, eine (Meta-)Thematisierung der Nahostdebatte dieser Tage auf die (wie gesagt: wichtige) Frage zu reduzieren, wo israelbezogener Antisemitismus anfängt. Man muss diese Frage stellen. Aber angesichts des palästinensischen Leids und der massiven israelischen Völkerrechtsverstöße in Gaza und West Bank kann das nicht der alleinige Fokus sein. Wenn mir dann aber direkt Fragen mit entsprechendem Fokus gestellt werden, ringe ich um Worte.
Auch in den Antworten, die ich auf einige dieser Fragen für richtig halte, hat sich einiges geändert. Wenn mich am 8. Oktober 2023 jemand gefragt hätte, ob die Rede von einem israelischen Genozid in Gaza antisemitisch ist, hätte relativ schnell und deutlich „ja“ geantwortet. Am 7. Oktober wurden Israelis Opfer eines Massakers mit genozidalen Zügen. Israel am Tag danach eines Genozids zu beschuldigen, zeugt von einer verzerrten Sichtweise, die kaum anders als durch Antisemitismus zu erklären ist.
Heute ist die Lage anders. Ich halte die Rede vom Völkermord immer noch für nicht hilfreich. Die Antwort hängt ohnedies von der Definition ab: Wenn man einer sehr weiten Lemkin‘sche Definition folgt, ist es ein Genozid (dann gäbe es sehr viele Genozide). Wenn man (wie in Deutschland und Israel weit verbreitet) Genozid per definitionem als eine dem Holocaust ähnliche Tat versteht, bei der alle Angehörigen einer Gruppe ermordet werden sollen, ist es sicher kein Genozid (dann gäbe es historisch nur sehr wenige Genozide). Wenn man der völkerrechtlichen Definition folgt, hängt es davon ab, ob man der israelischen Regierung eindeutig eine entsprechende Intention nachweisen kann. Ich sehe nicht, wobei es helfen soll, diese Diskussion zu führen.
Die israelischen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sind ganz unabhängig von der Frage nach der Angemessenheit des Genozidbegriffs so offensichtlich, massiv und systematisch, dass ihre Verurteilung gar nicht auf den Genozidbegriff angewiesen ist. Das israelische Vorgehen steht schon lange in keiner verhältnismäßigen Relation zu irgendeinem legitimen Kriegsziel mehr. Die deutliche Kritik an diesem Vorgehen ist legitim. Und wenn diese Kritik das Wort Genozid nutzt, dann finde ich das zwar „nicht hilfreich“, aber ich finde es anders als im Oktober 2023 auch nicht mehr in dem Maße absurd falsch, dass man es pauschal als antisemitisch einstufen sollte. (Das alles ist freilich kein Grund, denjenigen über den Weg zu trauen, die schon am 8. Oktober anfingen, von einem Genozid in Gaza zu sprechen.)
Man kann dann immer noch fragen, warum die entsprechenden Aktivist:innen sich so viel weniger über andere Gewalttaten aufregen, die nach der Lemkin’schen Definition sicherlich, nach der völkerrechtlichen Definition vielleicht ein Genozid wären. Aber ein hinreichender Grund, konkreten Personen Antisemitismusvorwürfe zu machen, ist das allein noch nicht. Diese Aktivist:innen sind ja keinesfalls allein damit, dass sie Israel und Gaza mehr Aufmerksamkeit widmen als Tigray oder Darfur oder Nagorno-Karabach.
(P.S.: Die These, es gebe nur das Wort Israelkritik, nicht aber das Wort Palästinakritik, ist nun auch widerlegt.)