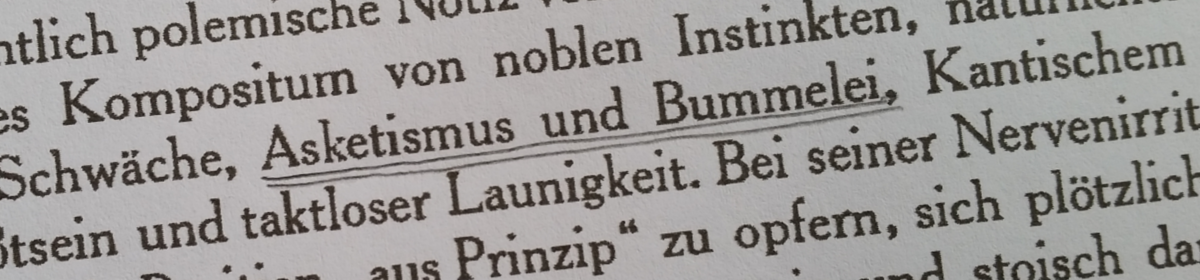Ich überblicke nicht, welche parteiinternen Dynamiken Die Linke dazu bewegt haben, sich offiziell gegen Antisemitismusdefinition der IHRA und für die der Jerusalem Declaration zu entscheiden. Aber so viel sei gesagt:
Die „IHRA-Definition“ ist als Antisemitismusdefinition schlicht ungeeignet. Eine Definition darf nicht Worte wie „eine bestimmte“ enthalten, wenn dann keine *Bestimmung* folgt. Also ja, man kann sagen: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann.“ Aber eine Definition wäre das nur, wenn dann Kriterien folgen würden, anhand derer man entscheiden könnte, ob eine zur Diskussion stehende „Wahrnehmung“ eine „bestimmte“ im Sinne der Definition ist. Solche Kriterien folgen aber nicht, sondern nur unsystematische Beispiele.
Die Jerusalem Declaration ist auf dieser formalen Ebene deutlich besser. Sie enthält in der Tat eine Definition von Antisemitismus (nicht unbedingt meine, aber eine). Antisemitismus wird hier definiert als „Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden (oder jüdische Einrichtungen als jüdische)“. Auch das lässt freilich Fragen offen — nämlich nach der Definition von Diskriminierung usw. Aber dabei handelt es sich eben um definierbare Begriffe und nicht um vage Worte wie „bestimmte“. Allerdings wird auch die Jerusalem Declaration absurd schlecht, wenn es am Ende lapidar heißt: „Boykott, Desinvestition und Sanktionen sind gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten. Im Falle Israels sind sie nicht per se antisemitisch.“ Das ist wahrscheinlich das Ergebnis anstrengender Kompromissverhandlungen. Der Satz ist „an sich“ nicht falsch (je nachdem, wie man „Gewalt“ definiert). Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel müssen nicht in jedem denkbaren Falle antisemitisch sein, sind es also nicht „an sich“. Aber eine Antisemitismuserklärung, der zu BDS nichts anderes einfällt, als zu sagen, dass die BDS-Methoden „an sich nicht antisemitisch“ sind, ist intellektuell und politisch ebenfalls gescheitert. Zum einen lädt sie sehr offensiv dazu ein, als pauschale Deproblematisierung von BDS gelesen zu werden. (Natürlich kann man immer sagen, dass es ja keine pauschale Deproblematisierung ist, aber wenn man nur die teilweise Negation der Problematisierung formuliert, ohne auf Probleme zu verweisen, darf man sich nicht beschweren.) Zum anderen weicht sie der Frage aus, unter welchen Bedingungen BDS „für sich“ dann oftmals doch antisemitisch ist.
Angesichts dieser Probleme beider „Definitionen“ kann es nicht überraschen, dass sie in der deutschen Öffentlichkeit heute in erster Linie politische Bekenntnisse sind. Gerade, weil sie das sind, wäre es für eine politische Partei womöglich klüger, kein Bekenntnis abzulegen, von dem sie wissen muss, dass sie damit viele (und insbesondere viele Jüd:innen und jüdische Organisationen) vor den Kopf stößt. Man könnte es ja einfach lassen. Wer keine Hausarbeit über Antisemitismus schreibt, muss sich nicht zwingend zu einer Antisemitismusdefinition bekennen.