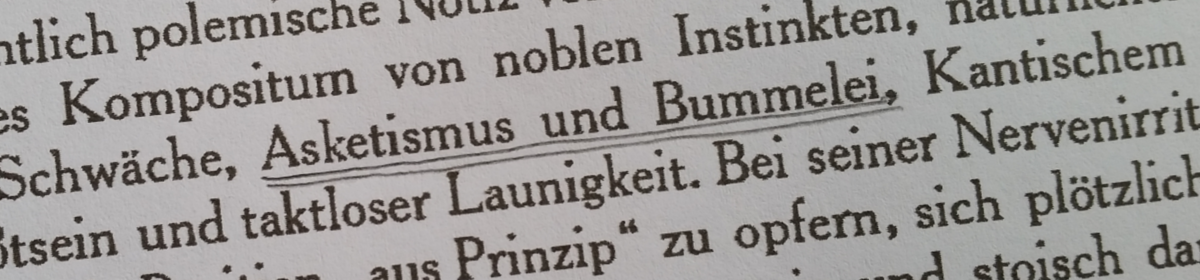Im November habe ich im Tagesspiegel behauptet, dass wir keinen gesellschaftlichen Rechtsruck erleben, um im Dezember dann in der taz darzulegen, warum ich die AfD mittlerweile als rechtsextreme Partei einordne. Auf den ersten Blick besteht zwischen beiden Thesen ein Widerspruch: Wie kann es sein, dass eine im Kern rechtsextreme Partei mit zweistelligen Wahlergebnissen in die Parlamente einzieht, wenn die Gesellschaft nicht nach rechts rückt? In diesem Text erläutere ich, wie beides zusammengeht.
Dazu verdeutliche ich erst, dass zwischen den Thesen ohnehin kein direkter Widerspruch besteht (1), und führe anschließend aus, dass beide etwas differenzierter formuliert werden müssten, als es in den Zeitungsartikeln möglich war (2 und 3). Darauf gehe ich noch auf die hufeisenförmigen Probleme des Rechtsextremismusbegriffs ein (4) und erläutere abschließend, wie die Kategorisierung der AfD als rechtsextreme Partei mit meiner im September in der Prokla veröffentlichten Verteidigung des Rechtspopulismusbegriffs vereinbar ist (5).
1 Die Formierung eines rechten Projekts in einer zunehmend liberalen Gesellschaft
Es ist nicht leicht, das, was sich seit etwa zehn Jahren rund um Sarrazin, Pegida, AfD und Co. diskursiv und organisatorisch herausbildet, angemessen zu bezeichnen. Einen sehr hilfreichen Ansatz bietet Sebastian Friedrich, der von der „Formierung eines rechten Projekts“ spricht. Diese Formulierung ist vage genug, um das, was da passiert, in seiner einstweiligen Unförmigkeit und Vielfalt zu umfassen. Zugleich ist sie deutlich genug, um darauf zu verweisen, was neu ist: Wo über längere Zeit Zersplitterung und Stigmatisierung dafür sorgten, dass das schon lange bestehende radikal rechte Potenzial nicht systematisch mobilisiert wurde und deshalb politisch vergleichsweise wirkungslos blieb, formiert sich nun etwas. Und dieses sich formierende Projekt könnte die politische Landschaft mittelfristig grundlegend verändern.
Es wäre plausibel anzunehmen, dass es zu einer rechten Formierung gerade dann kommt, wenn die ganze Gesellschaft nach rechts rückt: Dann wüchse das Potenzial, das für ein rechtes Projekt mobilisiert werden könnte, sodass eine entsprechende politische Formierung umso wahrscheinlicher würde.
Aber das muss nicht so sein. Auch eine ganz andere These ist plausibel: Rechte Projekte können sich auch gerade dann formieren, wenn sich die Gesellschaft insgesamt liberalisiert – als Rückzugsgefecht oder Gegenmobilisierung, mit der gesellschaftlicher Wandel aufgehalten oder umgekehrt werden soll.
Diese zweite Deutung ist in Bezug auf die Bundesrepublik deutlich plausibler. Die Gesellschaft hat sich in den letzten 50 Jahren in fast allen Sphären zunehmend liberalisiert. Und weil sich die Gesellschaft liberalisiert hat, „mussten“ auch die großen Parteien in gewissem Maße mitziehen, wenn sie noch Wahlen gewonnen wollten. Eine CDU, die die gesellschaftspolitischen Positionen von Helmut Kohl oder gar Konrad Adenauer vertreten würde, würde heute zwar der AfD einige Stimmen abziehen, aber wohl trotzdem nur auf 20 bis 30% kommen. Die Liberalisierung der Parteien wiederum führt dazu, dass die Teile der Gesellschaft, die die Liberalisierung ablehnen, sich von diesen Parteien nicht mehr repräsentiert fühlen und offen für eine neue Form der rechten Mobilisierung sind – eine gute Gelegenheit für die Formierung eines rechten Projekts.
Somit kann eine zunehmend liberale Gesellschaft zumindest kurz- und mittelfristig gute Entstehungsbedingungen für die Etablierung einer Rechts-außen-Partei wie der AfD bieten. Ein logischer Widerspruch zwischen beiden Beobachtungen besteht nicht.
2. Die Ambivalenz der Liberalisierung
Dies gilt umso mehr, als die angesprochene Liberalisierung der Gesellschaft selbst ein ambivalenter Prozess ist – denn Liberalismus ist immer ambivalent. Liberalismus ist eine politische Ideologie oder Ordnung, in deren Mittelpunkt freie und gleiche Individuen sowie deren Rechte stehen. Eine liberale Ordnung ist jedoch immer auf staatliche Organisation angewiesen – ohne Staatsgewalt gibt es kein Recht. Liberale Staaten wiederum existieren (zumindest bislang) immer in Form mehr oder minder souveräner Nationalstaaten. Solche Staaten haben nicht nur einen Sicherheitsapparat, der das liberale Recht nach innen notfalls mit Gewalt durchsetzt, sie haben auch nach außen Grenzen, die „geschützt“ werden müssen, und sie haben Außenpolitik, in der sie sich in „Anarchie“ mit anderen Staaten begegnen. In allen drei Bereichen ist ein gewisses Maß an Illiberalität angelegt. Zudem stehen liberale Ordnungen (zumindest bislang) immer in Verbindung mit einer kapitalistischen Ökonomie, die systematisch Konkurrenz und Ungleichheit produziert. Dies lässt sich im nationalen und regionalen Rahmen mithin sozialdemokratisch-korporatistisch einhegen, global aber bislang nicht. Diese Konkurrenz- und Ungleichheitsverhältnisse begünstigen die illiberalen Politiken in den oben genannten Bereichen noch weiter. Somit ist davon auszugehen, dass Liberalisierung immer ein ambivalenter Prozess ist, der in einigen Bereichen Freiheit und Gleichheit erweitert, in anderen aber einschränkt – ohne dass es sich um ein Nullsummenspiel handeln müsste.
Entsprechend haben sich in den letzten 50 Jahren gesellschaftlich und politisch auch Tendenzen entfaltet, die man mit guten Gründen als „rechts“ bezeichnen könnte. Hierzu zählen beispielsweise die ökonomischen Liberalisierungsprozesse, die Ungleichheit fördern und zudem ohne autoritäre Politiken kaum durchzusetzen sind – ein sichtbares Beispiel bilden die Agenda-2010-Reformen mit der Einführung der Hartz-IV-Sanktionen. Auch die Ausweitung der polizeilichen Handlungsspielräume durch Polizeigesetznovellierungen auf Länderebene, sowie diverse Einschränkungen des Grundrechts auf Asyl sind schwerlich als Liberalisierung zu fassen – aber durchaus als Ausdrücke der Ambivalenz von Liberalisierungsprozessen.
Schließlich erreichen Liberalisierungsprozesse nicht alle sozialen Gruppen in der gleichen Weise – einige Gruppen bleiben außen vor und erleben die Veränderungen mithin als Gefährdung. Daher kann sich die Ambivalenz von Liberalisierungsprozessen auch in einer Politisierung und Radikalisierung derjenigen Kräfte zeigen, die nicht liberal gesonnen sind. So zeigen die Leipziger Mitte- bzw. Autoritarismus-Studien zwar keine zunehmende Verbreitung autoritärer und gruppenbezogen-menschenfeindlicher Einstellungen, aber bei einigen Gruppen eine erhöhte Bereitschaft, diesen Einstellungen auch Taten folgen zu lassen.
Diese Ambivalenzen ändern nichts daran, dass die Gesellschaft sich über die letzten 50 Jahre hinweg betrachtet eher liberalisiert hat, als dass sie sich den Vorstellungen angenähert hätte, die Björn Höcke oder Götz Kubitschek vertreten. Sie machen es aber umso plausibler, dass gesellschaftliche Liberalisierung und rechte Formierung zeitlich zusammenfallen können.
3. Extreme Partei, radikale Wähler_innen? Die relative Gleichgültigkeit der AfD-Wähler_innen gegenüber ihrer Partei
Auf der anderen Seite ist auch die Kategorisierung der AfD als rechtsextreme Partei zu qualifizieren: Diese Einordnung beruht in erster Linie darauf, dass die als rechtsextrem einzuordnenden Kräfte innerhalb der Partei immer dominanter werden. Diese innerparteiliche Machtverschiebung ist im internationalen Vergleich noch bemerkenswerter, zeigt sich doch bei Rechts-außen-Parteien in Ländern wie Schweden und Frankreich gerade die gegenteilige Entwicklung. Jedoch wird die zunehmende Radikalisierung bzw. „Extremisierung“ der AfD eher durch innere Dynamiken angetrieben als dadurch, dass ihre Wähler_innen nach möglichst offen rechtsextremen Positionen verlangen würden.
Vielmehr deutet vieles darauf hin, dass der Mehrzahl der AfD-Wähler_innen die genauen Positionen der Partei relativ gleichgültig sind. Solange diese Partei das Bild einer radikalen Opposition gegen die vermeintlich Herrschenden abgibt, sich kontinuierlich gegen Migration positioniert und regelmäßig herabwürdigende Kommentare gegen Minderheiten äußert, wird die Partei gewählt. Es gibt (insbesondere, aber nicht nur in Ostdeutschland) Gegenden, in denen die AfD zweistellige Ergebnisse einfahren würde, ganz unabhängig davon, ob die Partei von Gauland, Meuthen, Höcke, Kalbitz, Pazderski oder Petry angeführt würde – oder von einem blau gefärbten Teddybär, der auf Knopfdruck rassistische Sprüche raushaut. Offener Faschismus wird von zahlreichen AfD-Wähler_innen nicht dezidiert eingefordert, aber zumindest in gewissem Maße billigend in Kauf genommen.
Dennoch tut die AfD gut daran, dass sie anders als etwa die Goldenen Morgenröte in Griechenland oder die L’SNS in der Slowakei als Gesamtpartei nicht das Bild faschistischer Militanz pflegt. Eine in diesem Sinne offen rechtsextreme Partei würde es gerade in Westdeutschland schwer haben, bei Wahlen erfolgreich zu sein. Es gibt zwar in Ost und West ein genuin rechtsextremes Wähler_innenpotenzial, das auch die NPD in der Vergangenheit regelmäßig in kommunale und Landesparlamente gebracht hat. Wie jedoch die Ergebnisse der NPD erahnen lassen und die Einstellungsforschung bestätigt, wäre es selbst bei vollständiger Mobilisierung dieses Potenzials schwer, allein auf dieser Grundlage bundesweit sicher über 5% kommen – von der Gefahr eines Verbots ganz zu schweigen.
Für den Erfolg der AfD ist es bislang entscheidend, dass sie neben dem fortbestehenden NPD-Potenzial auch Milieus anspricht, die von allzu offenem Rechtsextremismus eher abgeschreckt würden. Und genau deshalb verfolgen die extrem rechten Akteure in dieser Partei auch das Projekt der „Selbstverharmlosung“ (Götz Kubitschek).
Somit lassen sich die in den letzten 50 Jahren in der Bundesrepublik präzedenzlosen Erfolge einer rechtsextremen Partei erklären, ohne dass man dafür annehmen müsste, dass die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen zugenommen hätte oder die Gesellschaft als ganze nach rechts gerückt wäre.
4. Alle Begriffe sind schlecht, man sollte sich für den am wenigsten schlechten entscheiden
Man wird für alles und jeden beliebig viele Begriffe finden, die sich in der Sache rechtfertigen lassen – auch für die AfD. Diese kann man mit guten Gründen bezeichnen als: eine Partei, eine aus Protest gegen die „Eurorettungspolitik“ entstandene Partei, eine Rechtspartei, eine Rechts-außen-Partei, eine rechtspopulistische Partei, eine populistische Partei, eine rechtsradikale Partei, eine rechtsextreme Partei, eine völkisch-nationalistische Partei, eine relativ junge Partei, eine demokratisch gewählte Partei, eine Partei, von der sich die übergroße Mehrheit der Bevölkerung wünscht, dass sie auf keinen Fall an die Regierung kommt, eine Partei mit Doppelspitze, eine von Männern dominierte Partei, eine Partei mit zahlreichen Verbindungen zu Neonazis, eine Partei mit Dreibuchstabenkürzel – usw. usf. All diese Kategorisierungen sind in der Sache rechtfertigbar, aber nicht alle sind sinnvoll.
Eine sinnvolle Bezeichnung sollte die Sache treffen und dabei zugleich diejenigen Aspekte hervorheben, auf die es im jeweiligen Kontext ankommt. Bei der Einordnung von Parteien kommt es in der Regel zuvorderst auf ihre politische Ausrichtung an. Zudem sollte ein sinnvoller Begriff gegebenenfalls die von einer Partei ausgehenden Gefahren für Freiheit, Gleichheit und Demokratie sichtbar machen. Es geht dabei nicht darum, den Begriff zu suchen, der die AfD am grellsten stigmatisiert, sondern darum, sie möglichst präzise einzuordnen – diese Einordnung kann aber ein wertendes Urteil beinhalten. In der öffentlichen Debatte schließlich sollte ein sinnvoller Begriff so gewählt sein, dass er zwar sozialwissenschaftlich korrekt, aber auch für Personen ohne sozialwissenschaftliche Ausbildung verständlich ist.
Legt man diese pragmatischen Kriterien an, wird schnell deutlich, dass alle Begriffe schlecht sind – sie alle sind in gewissem Maße uneindeutig, ungenau, missverständlich, legen falsche Alltagstheorien nahe oder vernachlässigen entscheidende Facetten des Phänomens.
In meinem taz-Artikel plädiere ich für den Rechtsextremismusbegriff. Dieser scheint mir in der Sache wissenschaftliche spätestens gerechtfertigt, seit sich beim Bundesparteitag der AfD Ende November/Anfang Dezember zeigte, dass in der Bundespartei gegen den Willen des „Flügels“ mittlerweile keine wichtigen Entscheidungen mehr getroffen werden können. Diese Strömung scheint mittlerweile knapp die Hälfte der Delegierten fest auf der eigenen Seite zu haben und einige weitere bei Einzelfragen mobilisieren zu können. Weil zentrale Akteure des „Flügels“ mehrfach deutlich gemacht haben, dass sie nicht nur wie der Rest der Partei routinemäßig Minderheiten herabwürdigen, sondern darüber hinaus auf eine Politik- und Gesellschaftsordnung jenseits des liberaldemokratischen Rahmens zielen, scheint die in der Parteienforschung etablierte Grenze zwischen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus mit der innerparteilichen Dominanz dieser Kräfte überschritten. Zudem macht der Begriff die Gefahren deutlich, die von der Partei für Demokratie, Freiheit und Gleichheit ausgehen und wird von den meisten Nicht-Sozialwissenschaftler_innen genau so verstanden.
Jedoch hat der Begriff auch einen erheblichen Nachteil, den er sich mit dem Rechtsradikalismusbegriff und dem Rechtspopulismusbegriff teilt: Er lädt zu einer „hufeisentheoretischen“ Modellierung des politischen Raums ein, bei der rechts und links der guten demokratischen „Mitte“ „radikale“, „extreme“ oder „populistische“ Gefahren lauern. Diese Hufeisentheorie ist in der Sache unhaltbar und politisch schädlich. Das Problem besteht dabei wohlgemerkt nicht darin, dass es keine antidemokratischen Kräfte gäbe, die sich als links verstehen und die Freiheit und Gleichheit in der Gesellschaft gefährden könnten, wenn sie mehr Einfluss erlangten. Diese Kräfte gibt es sehr wohl, wenn sie auch in Deutschland aktuell eher schwach sind. Vielmehr besteht das Problem in der Idee, dass die „Mitte“ harmlos sei und Demokratiegefährdung grundsätzlich von irgendwelchen weit von dieser „Mitte“ entfernten „Rändern“ ausgehe. Der Rechtsextremismusbegriff ist schon in seiner Entstehung mit dieser Modellierung verbunden und reproduziert sie in gewissem Maße bei jeder Nennung.
Jedoch verschwindet das Hufeisendenken auch dann nicht, wenn man einen anderen Begriff wählt. Nur weil man von völkischem Denken, Faschismus oder Autoritarismus spricht, würden Konservative und Liberale nicht aufhören, vor der „Gefahr von Links“ zu warnen, die man nicht vernachlässigen dürfe. Deshalb ist es so oder so unumgänglich, der Extremismustheorie mit Argumenten zu begegnen – und die Argumente werden nicht dadurch stärker oder schwächer, dass man von Rechtsextremismus spricht.
Zudem haben die nicht hufeisenförmigen Begriffe allesamt selbst erhebliche Probleme: Der Begriff „autoritär“ ist viel zu vage; der Begriff „völkisch“ ist nur für ein kleines Publikum verständlich, der Begriff „faschistisch“ ist zu eng mit einem historischen Phänomen assoziiert und relativ unterbestimmt; der Begriff „protofaschistisch“ suggeriert ein zeitliches „Davor“ etc.
Somit finde ich all diese Begriffe (und überhaupt alle Begriffe) schlecht. Noch schlechter fände ich dagegen den Verzicht auf Begriffe (das würde ein Sprechen unmöglich machen) oder die Kreierung von immer neuen Begriffen (das stiftet nur noch mehr Unübersichtlichkeit).
So scheint mir der Rechtsextremismusbegriff der am wenigsten schlechte zu sein, wenngleich er wirklich ziemlich schlecht ist.
Extrem populistisch?
Während ich die AfD im Dezember in der taz als rechtsextrem bezeichne, verteidige ich in der Prokla im September den Populismusbegriff und verwende ihn auch auf die AfD. Zwischen beiden Einordnungen besteht kein Widerspruch. Vielmehr betrachte ich die Partei als populistisch und als rechtsextrem, halte aber je nach Kontext die eine oder die andere Bezeichnung für sinnvoller.
Dies ist deshalb möglich, weil ich unter „Rechtspopulismus“ keine „harmlosere“ oder weniger „extreme“ Form des Rechts-Seins verstehe als unter „Rechtsextremismus“. Vielmehr verstehe ich darunter – ebenso wie weite Teile der Wissenschaft – eine bestimmte ideologische Form, in der „das gute Volk“ gegen „die bösen Eliten“ ausgespielt und die Herstellung der vollen Souveränität „des guten Volkes“ gefordert wird. Somit liegt die Unterscheidung populistisch/nicht-populistisch quer zur Unterscheidung rechtsextrem/nicht-rechtsextrem. Eine Partei kann populistisch und rechtsextrem, nichtpopulistisch und nicht rechtsextrem, populistisch und nicht rechtsextrem oder nichtpopulistisch und rechtsextrem sein. Und auch der Nationalsozialismus ist (darin stimme ich eher Jan-Werner Müller als Cas Mudde zu) durchaus im oben genannten Sinne als „populistisch“ einzustufen, obwohl er ohne Zweifel „rechtsextrem“ und ganz sicher nicht harmlos war.
Der Populismusbegriff hat seine Stärken, wenn es darum geht, den Aufstieg der AfD und anderer Parteien zu erklären. In der Öffentlichkeit dominiert jedoch eine relativ beliebige Verwendungsweise des Begriffs, in der Populismus zwar als fragwürdig, aber doch als weniger „gefährlich“ und „extrem“ als Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus gilt. Daher führt der Begriff in der Öffentlichkeit oft eher zur Verharmlosung.
Wenn es nicht spezifisch um die populistische Dimension geht, macht es hier deshalb mehr Sinn, inhaltlich spezifischer Begriff zu nutzen, die auch so verstanden werden, je nach Partei also etwa von „Rechtsradikalismus“ oder „Rechtsextremismus“ oder „rechts außen“ zu sprechen (oder, wenn meine Argumente aus Teil 4 nicht überzeugt haben, von Faschismus, Neofaschismus, Autoritarismus und völkischem Nationalismus).