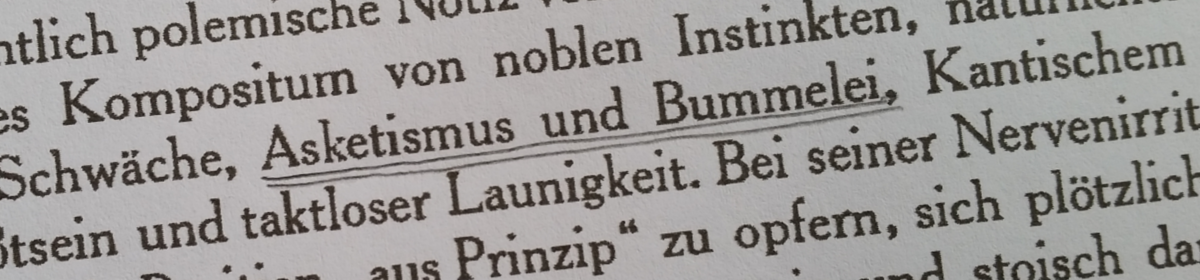Im Rahmen einer vom Arbeitskreis Neue Rechte der Tübinger Fachschaft Politik organisierten Podiumsdiskussion debattierte ich am 18. Dezember mit Alice Blum und Thomas Wagner darüber, ob und wie man in sozialwissenschaftlicher Forschung und politischer Öffentlichkeit „Mit Neuen Rechten reden“ sollte. Im Folgenden eine ausformulierte Version meines Spickzettels.

Mit Neuen Rechten reden in der Forschung
In der Diskussion über die Notwendigkeit des Mit-Neuen-Rechten-Redens in der wissenschaftlichen Forschung kann ich mich kurzhalten. In meiner Forschung geht es zwar auch um Rassismus und Rechtspopulismus und somit zumindest am Rande um die Neue Rechte. Für die in erster Linie konzeptionellen und politisch-soziologischen Fragestellungen, die ich verfolge, reicht aber die Auseinandersetzung mit Sekundäranalysen, Daten und Dokumenten weitgehend aus. Daher kann ich anders als Thomas Wagner und Alice Blum neben mir nicht aus Erfahrung sprechen, habe aber dennoch eine Meinung zum Thema, die ich kurz darstellen möchte.
Ich sehe keinen Grund für eine prinzipielle ethische oder methodologische Ablehnung des Redens mit Neuen Rechten im Rahmen von sozialwissenschaftlicher Forschung. Wenn man überzeugt ist, in Ethnographien und Interviews mit Neuen Rechten Erkenntnisse gewinnen zu können, die durch eine Lektüre der verfügbaren Texte nicht zu erlangen sind, kann man dies tun. Jedoch sollte man dabei nicht naiv sein, wobei ich insbesondere zwei Punkte betonen möchte.
Erstens müssen Forscher_innen bedenken, dass die Neuen Rechten strategisch kommunizieren. Grundsätzlich gilt, dass Forscher_innen, die es mit politisch professionellen oder semiprofessionellen Akteur_innen zu tun haben, damit rechnen müssen, benutzt zu werden: Die beforschten Personen werden versuchen, die Forscher_innen genau das wissen zu lassen, von dem sie wollen, dass die Forscher_innen es wissen, glauben und schreiben. Diesem strategischen Handeln darf man niemals naiv gegenüberstehen – und für die Beforschung antidemokratischer Ideolog_innen gilt dies umso mehr. Sonst läuft man Gefahr, nicht nur sich selbst blenden lassen, sondern mit den eigenen Publikationen auch als kostenlose Öffentlichkeitsabteilung der Neuen Rechten zu agieren. Dementsprechend ist in der eigenen Analyse und um so mehr in den Publikationen eine deutliche kritische Rahmung vonnöten.
Zweitens ist mit dem Sachverhalt umzugehen, dass Neue Rechte Menschen sind – darauf beziehe ich mich an dieser Stelle nicht als ethische, sondern als kognitive Herausforderung. An sich ist die Feststellung, dass Neue Rechte Menschen sind, freilich banal – niemand würde dies bestreiten. Dennoch geht davon immer wieder eine gewisse Dissonanz aus. Dies liegt an der verbreiteten Wahrnehmung, dass es sich bei Rechten entweder um ganz und gar dumme Wesen oder um ideologische Dämonen handelt. Diese Einschätzung ist in Bezug auf ihr politisches Wirken durchaus nachvollziehbar. Allerdings führt sie zu einer Dissonanz, wenn die Rechten in der direkten Begegnung dann eben auch als lebendige Menschen mit Gefühlen, Geschichten, Verwundungen und so weiter sichtbar werden. Diese Banalität droht dann als überraschende Erkenntnis zu erscheinen und über das hinwegzutäuschen, um das es gehen sollte, nämlich um Ideologie und Politik. Man kennt ähnliche Diskussionen auch aus anderen Kontexten, etwa in Bezug auf den Film Der Untergang, in dem „Hitler als Mensch“ dargestellt wurde. Entsprechend ist es wichtig, auf die ideologisch-politische Ebene fokussiert zu bleiben; wiederum gilt es, sich selbst nicht blenden zu lassen und auch das eigene Publikum nicht zu blenden.
Mit Neuen Rechten Reden in der politischen Öffentlichkeit
Wenn es um die politische Öffentlichkeit geht, habe ich eine sehr viel stärkere Meinung zum Reden mit Neuen Rechten als in Bezug auf die sozialwissenschaftliche Forschung. Ich halte es nicht für sinnvoll, sondern für schädlich, ein solches öffentliches Gespräch gezielt zu suchen. Ich möchte das kurz in sechs Punkten begründen – die ersten drei sind eher normativ, die letzten drei eher strategisch.
Vorweg sei noch gesagt, was ich unter dem Reden mit Neuen Rechten verstehe. Als Neue Rechte mit großem N bezeichne ich den relativ kleinen Kreis von Intellektuellen und Aktivist_innen im groben Anschluss an Alain de Benoist in Frankreich und Armin Mohler in Deutschland, wie er untere anderem im Institut für Staatspolitik und der Identitären Bewegung aktiv ist. Beim Reden mit Neuen Rechten geht es also nicht darum, ob man dem rassistischen Großonkel beim Weihnachtsessen mit Argumenten widerspricht oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob man als Parlamentarier_in im Bundestag gegen die AfD argumentiert. Es geht darum, ob man den öffentlichen Austausch mit geschulten rechten Kadern aktiv sucht und fördert. Warum sollte man das also meiner Ansicht nach nicht tun?
Erstens: Wenn Demokratie irgendetwas bedeuten soll, muss ihr die Gleichheit aller zumindest als normative Richtschnur zugrunde liegen – eine Gleichheit an Würde und Rechten heißt es zumeist. Wie genau demokratische Gleichheit gesellschaftlich und politisch realisiert werden sollte, ist alles andere als selbstverständlich und muss entsprechend selbst Teil der demokratischen Aushandlung sein. Politische Positionen aber, die das Ideal der Gleichheit aller explizit oder performativ ablehnen und stattdessen irgendwelche Ideale von heroischer Männlichkeit oder völkischer Identität zur Richtschnur machen, bewegen sich gar nicht erst auf demokratischem Boden. Das ist noch kein Grund, sie zu illegalisieren, aber es besteht gewiss keine demokratische Pflicht, sie in die demokratische Debatte einzubinden. Paradox ist nicht die Forderung, solche Positionen bei demokratischen Debatten außen vor zu lassen; paradox ist die Forderung, sie einzubeziehen.
Zweitens: Freilich wird die Sache dadurch verkompliziert, dass die Neue Rechte sehr gut weiß, was in der Öffentlichkeit wie sagbar ist. Entsprechend hat sie sich darauf verlegt, ihre antiegalitäre Ideologie in einer Weise zu formulieren, die sich an den Grenzen des Sagbaren bewegt, um eben diese Grenzen zu verschieben. Das heißt freilich, dass man sich mit jedem Ausschluss eine Metadebatte über die Kriterien für den Ausschluss erkauft. Das scheint mir aber ein Preis, den man getrost zahlen kann, denn dann diskutiert man immerhin über einigermaßen sinnvolle Fragen, nämlich über Demokratie und Rassismus.
Drittens: Wir dürfen nicht vergessen, wie verdammt klein die Neue Rechte im engeren Sinne zahlenmäßig ist. Gemessen daran ist die ihr zugewiesene Aufmerksamkeit schon viel zu groß. Es gibt viele andere Minderheiten in Deutschland, die weniger öffentliche Sichtbarkeit haben, ohne antidemokratische Positionen zu beziehen. Entsprechend gibt es keinen normativen Grund, ausgerechnet der Neuen Rechten noch mehr Gehör zu verschaffen. Man darf ja nicht vergessen, dass Zeit, öffentliche Aufmerksamkeit, Kommentarspalten und Sendeplätze nur begrenzt vorhanden sind. Warum sollten wir dieses knappe Gut jetzt ausgerechnet denen geben, die grundlegende Normen der Demokratie ablehnen?
Viertens: Auch wenn keine demokratische Pflicht besteht, die Neue Rechte einzubinden, könnte man immer noch sagen, dass es strategisch sinnvoll ist. Dann heißt es, der Ausschluss mache die Neue Rechten nur noch stärker, weil es ihr den Reiz des Verbotenen verschaffe . Ich habe bislang noch keine wirklich überzeugenden Argumente für diese These gehört. Ich habe keine Angst vor den Argumenten der Neuen Rechten, sondern fühle mich gegen sie gut gewappnet. Das ist aber kein Grund, den öffentlichen Austausch aktiv zu suchen. Ich fühle mich auch gut dafür gewappnet in den eiskalten Neckar zu springen und das Ganze unbeschadet zu überstehen. Allerdings halte ich es einfach für keine sinnvolle Praxis und lasse es deswegen auch sein. Ähnliches gilt für den öffentlichen Austausch von Argumenten mit der Neuen Rechten: Ich erwarte mir davon keinen Erkenntnisgewinn und ich erwarte auch nicht, damit ihr Appeal zu mindern. Im Gegenteil ist zu vermuten: Stehen in der Öffentlichkeit auf der einen Seite die Hetze gegen Minderheiten, auf der anderen Seite rationale Argumente, wird es immer Personen geben, die sich von der Hetze in ihren Ressentiments bestärken lassen und gegenüber Argumenten verschlossen bleiben. Das heißt nicht, dass man nicht gegen Hetze argumentieren sollte: Im Gegenteil muss man es tun, weil es immer auch unentschiedene und offene Personen gibt, die mit Argumenten zu erreichen sind. Allerdings heißt es, dass man der Hetze sicher nicht künstlich noch mehr öffentliche Plattformen geben sollte.
Fünftens: Freilich kommt es in der öffentlichen Debatte auch auf das bessere Argument an – hoffentlich irgendwie ein bisschen zumindest. Viel wichtiger als die Argumente, die in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden, ist aber die Entscheidung über die Themen sowie das Framing der öffentlichen Diskussion. Wenn man nun den Austausch mit Neuen Rechten sucht, lädt man sie immer auch ein, diese Entscheidung aktiv mitzugestalten. Dann wird es am Ende eben um Identität, Kultur und Migration gehen – Themen also, über die ohnehin schon viel zu viel geredet wird. Auch bei Themen wie Wohnraumpolitik und sozialer Ungleichheit, über die viel mehr zu reden wäre, werden sie immer wieder den Bogen zu diesen falschen Auflösungen schlagen. Dann kann man noch so gute Argumente haben und am Ende steht trotzdem wieder nur noch mehr Hetze gegen Minderheiten.
Sechstens: Man hört allenthalben, es bestehe so etwas wie eine linke Hegemonie und gerade die bereite der Neuen Rechten den Boden. Das halte ich für allergröbsten Unfug. Gäbe es die vielbeschworene linke Hegemonie wirklich, dann würde in FAZ und SZ und Welt und Bild und taz täglich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel gefordert. Und wenn sie dort täglich in einer hegemonialen Weise gefordert würde, hätte die Umsetzung auch schon längst begonnen. Von einer solchen linken Hegemonie könnten wir in Wirklichkeit kaum weiter entfernt sein. Was wir stattdessen haben, ist eine weitgehende liberale Hegemonie. Diese ist durchaus Teil des Problems. Dies gilt nicht etwa, weil Liberalismus per se Schuld am Antiliberalismus wäre. Es gilt, weil die liberale Hegemonie eben auch für die neoliberalen Wirtschafts- und Sozialpolitiken steht, die den gesellschaftlichen Boden für den Aufstieg des Rechtspopulismus bereitet haben – wenn „die Linken“ irgendwann „die kleinen Leute“ verraten haben, dann geschah dies nicht in Form von „Identitätspolitik“, es geschah in Form der Agenda-2010-Reformen und vergleichbarer Politiken. Die beste Strategie gegen dieses Problem scheint mir aber nun nicht darin zu bestehen, ausgerechnet den rechten Feinden des Liberalismus mehr Gehör zu verschaffen. Stattdessen sollte man die liberale Hegemonie von links herausfordern.
Eine linke Strategie gegen den Rechtsruck kann sich nicht darauf beschränken, die Ideologie und Politik der Rechten zu analysieren, demaskieren, dekonstruieren oder lächerlich zu machen. Sie muss darin bestehen, ein politisches Programm zu erarbeiten, das für eine Mehrheit der Bevölkerung attraktiv ist. Statt mit neurechten Ideologen über Identität, Kultur und Ziegenkäse zu räsonieren, sollte die Linke lieber linke Politik machen und auf die Enteignung von Vonovia und Deutscher Wohnen hinarbeiten.
P.S.: Identitätspolitik und Neoliberalismus
Zur Vorbereitung der Podiumsdiskussion habe ich noch ein ein paar Sachen nachgelesen und bin dabei unter anderem auf Folgendes gestoßen. Diese zwei Sätze aus der Zeit sagen meiner Ansicht nach sehr viel über den Diskurs über Neoliberalismus und Identitätspolitik. Wenn ein Linker (hier: Thomas Wagner) behauptet, die Linke habe einen Fehler gemacht, indem sie zum Einen neoliberal und zum Anderen identitätspolitisch geworden sei, wird im liberalen Mainstream (hier: Adam Soboczynski in Die Zeit) genau die Hälfte dieser Aussagen aufgenommen. Man muss nicht lange raten, welche das ist:
„Da hat Wagner, im Gegensatz zu seiner Kritik an den Hartz-IV-Reformen, natürlich vollkommen recht: Die derzeit vehement betriebene Identitätspolitik vieler Linker entfernt sich in gleichem Maße vom Universalismus der Aufklärung wie die Neue Rechte.“
Wenn es so ist, dann war unter Hartz-IV/Gedöns-Schröder doch alles bestens! Und so endet der Artikel dann auch mit einem beherzten liberalen Hufeisenwurf:
„Man lernt in diesem durchaus anregenden Buch: Nicht die Linke ist der Hauptgegner der Neuen Rechten, sondern das liberale Bürgertum. Nicht die Rechte ist der Hauptgegner der orthodoxen Linken, sondern das liberale Bürgertum. Nach der Lektüre zahlreicher Querfront-Gedanken, in denen nationaler Sozialismus und sozialer Nationalismus in eins zu fallen drohen, erscheint die weltoffene, kapitalismusfreundliche, liberale, bürgerliche, etwas altmodische Gesinnung der Mitte so zukunftsfähig und integrativ wie nie.“