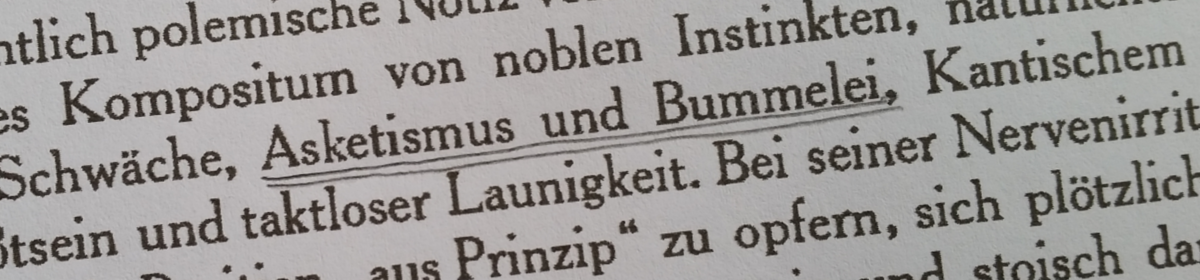Der sprichwörtliche Charme von Wes Anderons Filmen war schon in Grand Budapest Hotel zu einer schlecht konstruierten Persiflage seiner selbst geworden. Mit Isle of Dogs hat Anderson sich noch einmal überboten und ein klischeestarrendes Ungetüm von einem Film produziert.
*Spoiler Warning: Der Text enthält zahlreiche Plot-Details*
Ich[1] muss zugeben, dass ich in dreifacher Hinsicht nicht das ideale Publikum für Isle of Dogs bin. Erstens hat man sicherlich bessere Chancen, Gefallen an dem Film zu finden, wenn man ein zwölfjähriges Kind mit Hund ist oder zumindest als zwölfjähriges Kind einen Hund hatte; hatte ich aber nie. Zweitens könnte man den Film allein aufgrund der mit viel Liebe zum Detail gestalteten und in Stop-Motion-Kleinarbeit animierten Puppenwelt lieben; aber „technisch beeindruckend“ war für mich noch nie ein Qualitätsmerkmal – nicht bei Avatar, nicht bei Pacific Rim und nicht bei Isle of Dogs. Drittens bin ich mit deutlichen Vorbehalten in den Film gegangen, weil ich Andersons Alles-ist-so-furchtbar-charmant-und-liebevoll-Ästhetik schon in Grand Budapest Hotel eher anstrengend fand und nichts Gutes mehr davon erwartete.
Aber was ich dann gestern Abend im Kino sah, war noch einmal in anderer Hinsicht schlimm, als ich es erwartet hätte. Isle of Dogs ist alles, was an Wes Anderson falsch ist, in einem Film – mit einer Reihe zusätzlicher Falschheiten obendrauf.
Politisch bemüht, aber einfältig
Der Film wird weithin als politisch engagiertes Werk gefeiert. Aber wie es bei politisch engagierter Kunst so häufig der Fall ist, stellt sich diese Engagiertheit vor allem als Bemühtheit heraus und produziert selbst fragwürdige Bilder von Politik und Gesellschaft.
Der Bösewicht Kobayashi, seines Zeichens Bürgermeister der Metropole Megasaki (a.k.a. Erbe der bösen, hundefeindlichen, katzenliebenden Kobayashi-Dynastie), hat den Plan, alle Hunde loszuwerden. Er nimmt sich unter den Vierbeinern ausbreitende Krankheiten zum Anlass, alle Hunde der Stadt auf eine Mülldeponie-Insel zu deportieren, wo er sie schließlich mit Gas vergiften will – immer wieder ist mit eindeutiger Referenz an die Shoah von einer „endgültigen Lösung“ die Rede. Diese Vernichtungspläne verfolgt der Bürgermeister teils aus authentischem Hunde-Hass und teils, um die Bevölkerung im Kampf gegen einen inneren Feind hinter sich zu vereinen – das Feuilleton sieht darin vermutlich nicht zu Unrecht auch eine Anspielung auf Trump und andere Rechtspopulisten.
Dabei gibt sich Kobayashi immer wieder demokratisch und pluralistisch und lässt öffentlich schwache Gegenreden zu, während er im Hintergrund mit einer Verschwörung in Militär und Industrie jegliche Opposition ausschaltet und die Hunde-Vernichtung vorbereitet. Schlimmer noch: Diese Verschwörung hat die Hunde-Krankheiten, die Anlass für die hundefeindliche Politik werden, selbst gezüchtet und in Umlauf gebracht.
So weit, so schlecht ist das Bild von Autoritarismus als auf Massenvernichtung hinauslaufende Verschwörung schon. Es wird aber noch schlechter. Denn am Ende stellt sich raus, dass Kobayashi selbst noch Gutes in sich trägt und sein Hundehass durch kindlichen Zuspruch heilbar ist. Ganz anders ist es aber bei seiner rechten Hand Major Domo, einer ganz und gar unheimlichen Erscheinung ohne jeden menschlichen Zug, die am Ende versucht, die Vernichtung auch gegen Kobayashis Willen zu vollenden. So steht in dieser politischen Fabel hinter dem Demagogen am Ende noch das schlechthin Böse in Form einer dämonischen, nicht-menschliche Gestalt.
Aber das politisch Schlimmste kommt noch: Das vom guten Wissenschaftler (Natürlich ist die Wissenschaft das Gute, die Wissenschaft ist immer gut!) entwickelte Antiserum, das Hunde-Grippe und Schnauzen-Fieber heilen soll, wird von den guten Figuren auch dafür gelobt, dass es zugleich die Reproduktionsraten der Hunde reduziert. Das ist also die gute liberale Minderheitenpolitik, die gegen autoritäre Hetze ausgespielt wird: Man macht die Minderheiten gesund und ungefährlich und schränkt ihre Fruchtbarkeit ein. Eine hervorragende politische Parabel wird da erzählt.
Klischee, Klischee, Klischee – eine „Hommage“ an Japan
Man hätte diese Parabel freilich in jedem Setting erzählen können, aber Anderson entscheidet sich für ein japanisches Setting – man liest in Rezensionen, er habe viele japanische Filme gesehen und Isle of Dogs sei eine „Hommage“ an selbige sowie an das ganze Land. Das kann man schon so sehen, aber nur, wenn man kein Problem damit hat, eine Aneinanderreihung von Stereotypen als Liebeserklärung zu lesen. Der Film erweckt den Eindruck, als hätte Anderson eine Checklist mit kulturellen Klischees über Japan vor sich gehabt, die er Punkt für Punkt abarbeitete:
Erzählung alter Legenden durch japanisch aussehende Malerei: check
Samurai: check
Sumo: check
Dynastien: check
Corporations: check
Tee: check
Sushi: check
Roboter: check
Taiko-Trommeln: check
Schuluniformen: check
Megacity: check
Reispapiertüren: check
Naturkatastrophen: check (Erdbeben: check; Tsunami: check; Vulkanausbruch: check)
Yoko Ono: check (Okay, dass der Charakter namens Yoko Ono von Yoko Ono gesprochen wird, versöhnt ein wenig)
Vermutlich wurden auch Godzilla, Karate und Geishas referenziert, aber da muss ich wohl kurz eingeschlafen sein.
Angesichts der Tatsache, dass Japaner_innen an der Produktion den Credits nach zu urteilen in erster Linie als Synchronsprecher_innen beteiligt waren, überrascht es nicht, dass in den USA nun über Cultural Appropriation diskutiert wird. Ebenso wenig überrascht es, dass man in Deutschland für diese amerikanischen Debatten allenfalls ein wohlwollendes Kopfschütteln übrig hat – die Amis und ihre PC-Kultur eben, tss…
Unabhängig davon, wie man zur Aneignungsfrage steht, erschließt sich einfach nicht, was an einem solchen stereotypenstarrenden Ungetüm von einem Film nun noch „charmant“ oder „liebevoll“ sein soll.
Viele Jungs und ein weißes Mädchen
Wes Anderson hat schon immer Filme über weiße Jungs gemacht – jaja, über total schräge, crazy-liebenswürdige Outsider-Nerd-Jungs oder über von Bill Murray gespielte relativ alte Jungs, aber doch über weiße Jungs. Weibliche und nichtweiße Charaktere werden dabei vor allem dann relevant, wenn sie für diese Jungs relevant werden (Moonrise Kingdom war in Bezug auf Geschlecht die große Ausnahme).
In Isle of Dogs steigert sichauch diese Tendenz zu einem Klischee ihrer selbst. Dies gilt am stärksten für die Hunde-Charaktere. Hier sind sowohl die fünf Hunde der im Mittelpunkt stehenden Bande als auch der fieberhaft gesuchte Bodyguard-Hund Spots männlich. Weibliche Hunde tauchen dagegen (vom Mops Oracle abgesehen) ausschließlich als hübsche und schlanke potentielle Mating-Partner auf – die eine ist ein ehemaliges Model, die andere ein ehemaliges Versuchstier.
Bei den menschlichen Charakteren gibt es immerhin eine starke weibliche Figur – die dann aber ausgerechnet die einzige weiße und nicht-japanische Figur sein muss, nämlich die amerikanische Austausch-Schülerin Tracy. Und weil das so ist, ist es zwar ein Mädchen, das der großen Verschwörung auf die Schliche kommt und den Widerstand gegen selbige organisiert; aber es ist eben auch eine weiße Amerikanerin, die die verblendeten Japaner_innen wachrütteln und anführen muss. Im wörtlichen Sinne rütteln muss sie dabei insbesondere die Wissenschaftlerin Yoko Ono, die eine starke Figur hätte werden können, die aber nach dem Tod ihres männlichen Mentors nur noch in Passivität verharrt, bis die Lawrence-of-Arabia-Figur Tracy zu ihr kommt. Es versteht sich von selbst, dass dieses weiße Mädchen am Ende mit der männlich-menschlichen Hauptfigur zusammenkommt.
Eine ähnliche Lawrence-Geschichte wird auch bei den Hunden erzählt: Neben den deportierten Stadt-Hunden gibt es auf der Hunde-Insel auch noch ein „eingeborenes“ wildes Rudel, bei dem sich herausstellt, dass es sich um ehemalige Versuchstiere handelt. Und selbstverständlich machen diese den erstbesten Stadthund, der in ihre Mitte gerät, zu ihrem Anführer – wie Wilde das eben tun, selbst die edlen Wilden.
Wenn Wes Anderson mit Isle of Dogs das Ziel hatte, sich selbst zu persiflieren, ist ihm das gelungen. Wenn sein Ziel aber ein anderes war, hat er es gründlich verfehlt.
Anmerkungen:
[1] Der Text beruht auf einem Gespräch mit Sarah, die den Film ungefähr so gut fand wie ich und auf die einige der hier formulierten Beobachtungen zurückgehen.